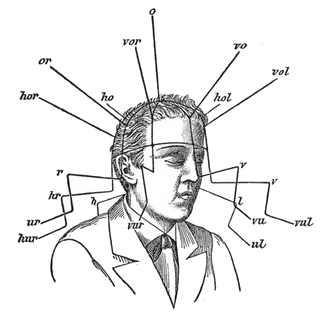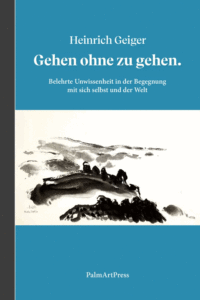 Der Tanz ist die Ethik des Gehens, also seine Verfeinerung und ästhetische Überhöhung. Aber auch das Gehen selbst ist schon raffinierte Lebenspraxis, was Heinrich Geiger in seinem Buch „Gehen ohne zu gehen“ zeigt.
Der Tanz ist die Ethik des Gehens, also seine Verfeinerung und ästhetische Überhöhung. Aber auch das Gehen selbst ist schon raffinierte Lebenspraxis, was Heinrich Geiger in seinem Buch „Gehen ohne zu gehen“ zeigt.
Heinrich Geiger: Gehen ohne zu gehen – Belehrte Unwissenheit in der Begegnung mit sich selbst und der Welt, Palm Art Press, Berlin, 2025, ISBN 978-3962582241, 25 €
Gehen ist nicht nur Ortsveränderung und Lokomotion, sondern auch Weltfündigkeit. Der Autor Heinrich Geiger meint damit die Schaffung eines Verhältnisses zur Welt, die es ohne Gehen nicht gibt. In dieser Hervorbringung zeigt sich der Welthorizont nicht nur von seinem Inventar und seinen Konstellationen her, sondern wird zu einer gelebten Einheit von Welt und Selbst.
Diese Verbindung mit den Dingen setzt „anstelle des Faktischen einen Austauschprozess“, „verändert die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt“ (S. 19), und schafft „eine Wiederanbindung an die Welt“ (S. 47). Gehen, verstanden als Wandern und Spazieren, kann in der Aneignung und im Loslassen von Welt eine Gelöstheit erzeugen. Sie entsteht im Wechselspiel von Welthervorbringung und Weltvernichtung.
Was bereits ist und was auch ohne Mensch und ohne gehenden Mensch da ist, wird durch das Gehen doch neu erfunden, verstanden im ontologischen Sinne als Selbstgegenwart und als gelebte Relation zur Welt, zum Selbst und zum Leib. Heinrich Geiger versteht also unter Gehen eine Produktion von Präsenz, in der nicht das Bedürfnis „etwas zu erschaffen“ erfüllt wird, sondern das „zu sein“ (17).
Die damit gemeinte Kommerzlosigkeit ist aber dennoch ein mentaler Kommerz, verstanden als Seinsökonomie, in der es zum Superplus des Lebens als seiner Selbststeigerung kommt. Diese Potenzierung „ermöglicht die Erneuerung der Beziehung des Menschen zur Welt“ (53). Somit gilt auch: der stets sitzende Mensch ist in dieser Hinsicht nicht sehr produktiv, was die Weltkonstitution angeht. Die Welt im Gehen ist nicht die Welt im Sitzen.
Gehen ist auch eine Praxis, um sich selbst zu fundieren, d.h. sich selbst Halt und Grund zu werden (vgl. S. 56 ff.). Der Mensch ist nicht bloß im Sinne von Existenz oder Nichtexistenz, da es innerhalb des Existierens noch den Modus (Seinsgrad) gibt, der von „kontingent“ bis „notwendig“ reicht. Wer sich selbst als kontingent empfindet, der ist zwar, aber er könnte auch ganz anders sein, sodass er sich beliebig fühlt. Hingegen bedeutet der Modus der Notwendigkeit, dass man sich selbst qua Existenz als in sich gegründet fühlt. Notwendigkeit bezeichnet damit einen Modus, sich selbst Grund und Fundament zu sein, also auf und in sich zu stehen.
Da sich viele Menschen permanent wie in einem 4-Sterne-Hotelzimmer fühlen, d.h. komfortabel aufgehoben zu sein, aber sich selbst als vollkommen austauschbar zu erfahren, ist das Gehen keine kleine Sache. Denn der beharrliche Fußgänger kann sich in seinem Modus von „kontingent“ zu „notwendig“ bewegen. Legt er eine lange Strecke zurück und kommt an seinen Ausgangspunkt wieder an, ist er wohl im Kreis gelaufen, aber seine Modalisierung hat sich wesentlich geändert.
Neben der Notwendigkeit ist für Heinrich Geiger auch der Zufall und die Freiheit für das Gehen wesentlich. Wer durch die Gegend geht, der setzt sich dem Zufall aus, zum Guten wie zum Schlechten, und erfährt so Welt und Dasein. Diese Form der Kontingenz ist ebenso unverzichtbar wie die Notwendigkeit als Seinsmodus.
Freiheit wird von Geiger auf praktische Weise verstanden, nämlich als Übergang von der Unfreiheit, sich selbst verhaftet zu sein, d.h. einem übersteigerten Selbstbezug inklusive „narzisstischer Sofortkommunikation“ als Selbstbestätigung in ein gelösteres Verhältnis zu sich selbst. Da man von selbst dazu neigt, ein zu enges Selbstverhältnis im Alltag auszubilden, ist dieser Übergang hin zur Lösung von sich oft zu haben.
Gehen findet im Raum statt, so auch im Rechtsraum. Das Recht ist nicht bloß eine Sammlung abstrakter Normen, sondern wird auch sinnlich konkret empfunden. Bricht ein Krieg in einem stabilen Rechtsraum aus, dann verändert sich die Raumwahrnehmung grundlegend. Wer vor dem Krieg noch selbstverständlich Spaziergänge unternahm, wird das im Kriegszustand nicht mehr tun, da nun das Recht des Stärkeren gilt. Selbst wenn es keine materiellen Kriegsschäden gibt, ist doch die Landschaft unerschließbar geworden.
Heinrich Geiger untersucht diese begehbaren Rechtsräume anhand der Überschreitung von Grenzen im China des 17. Jahrhunderts. Der Gang vom Zentrum Chinas an seine Peripherie und darüber hinaus bringt die Überschreitung des Herrschaftsbereiches und des kulturellen Raums Chinas mit sich, wodurch sich das Raumerleben fundamental ändert (vgl. 200 f.).
Raumerleben ist abstrakt ausgedrückt somit stets das konkrete Erleben abstrakter Ideen. In der Natur finden wir unsere Ideen wieder. Wir sehen, was unsere Ideen sind, die so in das Raumerleben einfließen, selbst zum Raum zu werden (vgl. 218 ff.). So etwas Einfaches wie ein Gang durch die Gegend ist also nicht unvermittelt, sondern ein Produkt der Ideenwelt. Der Autor zeichnet das anhand Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux nach.
Soll man nun einfach Drauflosgehen, ohne das Buch zu lesen, oder erst das Buch lesen, und dann losgehen? Anders gefragt: Lohnt es sich, es zu lesen? Es lohnt sich, aber Kritik gibt es ebenfalls.
Durch das Buch zieht sich ein aktualitätspolitischer Dauerkommentar, durch den die Praxis des Gehens immer wieder eingeholt, aber nicht geerdet wird. Der Autor versteht das Gehen als seinem Wesen nach politisch, was es auch ist. Doch wird diese politische Natur stets nur aphoristisch gestreift, sodass daraus ein leichter Kommentarzwang ohne Tiefe wird.
Gehen ist Selbstvergewisserung als Selbstregierung, also als Umgang mit sich selbst. Die durch die Gehpraxis hervorgebrachte Selbstgegenwart steht dabei immer für sich, ist nicht von Kriterien außerhalb seiner selbst abhängig, auch nicht durch den Imperativ, die politische Dauerkrise anhand der Thematik anzudenken. Das Besondere am Gehen, eine vollgültige Gegenwart zu besitzen, die als Selbstsein und Sichgegebensein eben nicht eingeholt werden kann, wird hier an fast jeder Stelle mit einem politischen Erniedrigungszeichen versehen. Der Autor sieht sich selbst als Gehender als leicht marginalisierter Mensch, der sich seiner Sache nicht so ganz sicher ist und zur liberalen Ironie neigt.
Heinrich Geigers Buch ist die Verdichtung hunderter Bücher und Aufsätze über das gehen. Wer also nicht all diese Bücher lesen will, der kann sich mit Gehen ohne zu gehen einen Überblick über den Stand der Dinge verschaffen. Die Stärke des Buches ist die Auswahl der Quellen gemäß dem subjektiven Interesse des Autors. Zum Beispiel schreibt er über einen Künstler, der im finnischen Packeis einen Spaziergang macht und hinter dem ein Eisbrecher den gerade beschrittenen Weg aufbricht. Das ist ein kleines Bild, das haften bleibt.
Solche Miniaturen werden im Buch sehr gut erschlossen, so wie auch übergreifende Ideen zum Gehen. Der Autor erschließt also den Stand der Dinge, die relevanten Bücher und Ideen, ohne sich dabei anzustrengen, womit auch das Buch selbst beim Lesen nicht anstrengt. Zugleich trifft er auch das, was das Gehen ausmacht, so das Baugefühl, die Lust am „es geht weiter“, die Selbststeigerung des Lebensgefühls, die Welt- und Selbsterschließung und das Gefühl von Sinn und Fundierung.
Sebastian Knöpker