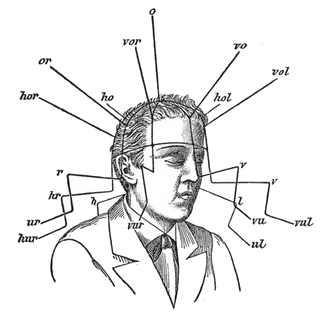Jeder Mensch besitzt ein dominierendes Lebens-gefühl, welches durch Verdichtung vieler Einzelerlebnisse zustande kommt, und sei es nur das Gefühl des Fehlens einer eigenen Biographie. Eine einfache Addition von Erlebnissen liegt in dieser Verdichtung jedoch nicht vor. Vielmehr ist die diachrone Identität einer Person ein unausgesetzter Vorgang, anders ausgedrückt, ist die eigene Biographie nicht ein einmal geschriebenes Verzeichnis von Vorfällen und Erlebnissen.
Jeder Mensch besitzt ein dominierendes Lebens-gefühl, welches durch Verdichtung vieler Einzelerlebnisse zustande kommt, und sei es nur das Gefühl des Fehlens einer eigenen Biographie. Eine einfache Addition von Erlebnissen liegt in dieser Verdichtung jedoch nicht vor. Vielmehr ist die diachrone Identität einer Person ein unausgesetzter Vorgang, anders ausgedrückt, ist die eigene Biographie nicht ein einmal geschriebenes Verzeichnis von Vorfällen und Erlebnissen.
Die Feststellung „Die Elbe ist über die Ufer getreten.“ fügt der konstatierten Überschwemmung nichts hinzu. Die Überschwemmung ist unabhängig von deren Feststellung gegeben, und also ist das Beurteilte vom Urteil nicht abhängig. Hingegen konstituiert das Urteil „Ich bin derselbe wie vor zehn Jahren“ wie alle Urteile über die eigene diachrone Identität diese Identität mit. M. a. W. könnte es keine personale diachrone Identität geben, gäbe es nicht unablässig Urteile hierüber, die diese Identität über eine Identifizierung erst mit hervor bringen. Die Biographie wandelt sich beständig, sie wird bearbeitet, sie arbeitet.
Diese Arbeit bzw. Bearbeitung der eigenen Vergangenheit ist leicht zu vergegenwärtigen, wirft man einen Blick auf die Praxis der Moral: ein der Tat überführter Dieb, den man dazu bringen möchte, sein Tun als Untat anzusehen, muss man nicht zuletzt seine Erinnerungen an den Diebstahl nehmen. Denn das originale Erleben des Diebes seiner Tat ist keineswegs mit Reue verbunden, sondern wie im Beispiel des Kellners, der einen Teil der Restaurantkasse stiehlt, mit Spannung, Konzentration, Angst und schließlich mit dem Triumph, das Begehrte an sich gebracht zu haben. Die Motive eines Kleinkriminellen können dabei überhaupt sehr idiosynkratisch sein und sich der Einordnung durch herkömmliche Moralvorstellungen gänzlich entziehen. Meint der Kellner etwa, durch den Diebstahl seine Souveränität gegenüber dem Patron bewiesen zu haben, so kann die entsprechende Freude beim Stehlen von der Moralvorstellung, Stehlen sei eine Sünde, kaum erfasst werden.
Soll der Dieb im nachhinein innerlich Reue zeigen, so muss Sorge dafür getragen werden, das nicht das Originalerlebnis erinnert wird, wie es tatsächlich war. Das wäre nämlich nur Reklame für das Stehlen. Erinnern muss er sich aber, da er ansonsten keine Reue entwickeln kann. Die Erinnerung muss so aussehen, dass (a.) der Dieb sich mit sich selbst identifiziert, aber (b.) sich nicht mit der positiven Einstellung zum Stehlen, sondern (c.) sich konterfaktisch als geläuterter Dieb in die Vergangenheit projiziert. Die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen und dem Erlebten muss also auf die Weise stattfinden, dass der Delinquent sich in Anwendung eines neuen Bewertungsmaßstabes erinnert. D. h. die Erinnerung muss unmittelbar Unwohlsein hervorbringen, das Gefühl also, Unrecht getan zu haben. Dabei ist dieses Unwohlsein nicht analytisch getrennt von der Erinnerung selbst. M. a. W. ist das Originalerlebnis in dem Doppelcharakter zu reproduzieren, dass die Evidenz des tatsächlich Erlebten bei gleichzeitiger erheblicher Veränderung des Gewesenen erhalten bleibt. Dass die Reproduktion des Originalerlebens und die neue Bewertung des Geschehenen zusammen als Ereigniserinnerung gewertet werden, ist dabei dafür entscheidend, sich überhaupt von seiner Vergangenheit distanzieren zu können. Dies gilt auch für den Dieb und seine Erinnerungen: er muss sich erinnern, um Reue empfinden zu können, aber er darf nicht tatsächlich das Erlebte wieder erinnern, weil dieses Werbung für Diebstahl wäre und nicht für Reue. Das ist ein Kunststück: ich erinnere mich, etwas gestohlen zu haben, erinnere mich auch an den Umstand und identifiziere mich zugleich mit einer Person, die ich jetzt bin, damals aber nicht gewesen sein kann. Logisch betrachtet ist dies unmöglich, von der Praxis der Erinnerung her gesehen jedoch nicht ungewöhnlich.
Die Synthese der diachronen Identität der Person durch Erinnerungsleistungen
In Bezug auf die Kultivierung der Stimmen der Erinnerung lässt sich diese Anfechtung des Erlebten noch einmal deutlich aufzeigen, indem die Bildung der diachronen Identität der Person als komplexer Prozess aufgefasst wird. Dieser Prozess, welcher die diachrone Identität konstituiert, jedoch keineswegs als bereits Bestehendes, etwa als durch die Zeit gleich bleibende Seele oder als biochemische Ausstattung (Gehirn), nachzeichnet, ist zunächst als etwas aufzufassen, was jenseits ethischer oder lebensweltlicher Bewertungen ein anthropologisches Faktum ist. Als solcher Prozess wird er hier zunächst beschrieben.
Das Erinnerungskriterium ist von zentraler Bedeutung für fast alle Theorien über die diachrone Identität der Person. Dies gilt für die Vertreter einer metaphysischen Entität, etwa für Platon in seinem Dialog Phaidon (1991), für Leibniz` Discours de la Métaphysique (1926) und für Richard Swinburnes Personal Identity (1984). Für alle psycho-physischen Identitätstheorien beginnend bei Lockes Essay Concerning Human Understanding (1975) über William James Principles of Psychology (1980) bis hin zu Derek Parfits Reasons and Persons (1984) gilt dies in noch viel stärkerem Maße.
Ereigniserinnerungen sind deswegen von großer Bedeutung, da sie die Verbundenheit mit der Vergangenheit zeitlich bestimmt anzeigen. Eine Erinnerung ist nicht bloß vage der Vergangenheit zugeordnet, sondern in der Regel bis auf wenige Tage oder in ungenaueren Fällen doch auf wenige Monate genau datiert. Diese Bestimmtheit ermöglicht auch das Erkennen der Kontinuität, was nicht unwesentlich ist, wird man sich darüber klar, dass zwischen dem Bestehen einer Kontinuität und dem Erkennen einer solchen a priori kein Zusammenhang besteht. Diese nun wird in erster Linie durch die Ereigniserinnerungen hergestellt und kaum durch psychische Eigenschaften, denn jene sind zeitlich unbestimmt. So ist z.B. die Schüchternheit einer Person, die sich durch ihr ganzes Leben zieht, als solche nur in der jeweilig gegenwärtigen Existenz präsent, ohne einen distinkten Hinweis auf ihre Persistenz zu beinhalten. Solche Indikatoren können nur Erinnerungen über Phasen der Schüchternheit oder konkrete Schüchternheitserlebnisse sein. In diesen Fällen wäre die Schüchternheit als personale Eigenschaft aber nur mittelbar von Bedeutung.
An offenkundigen Beschränktheiten der Erinnerung als Konstituent der diachronen Identität fehlt es nicht. Augustinus nennt in den Confessiones z.B. die mangelnde Reproduktionskraft ursprünglicher Empfindungen in den Erinnerungen, und Reid beschäftigt sich u.a. mit dem Problem der Transitivität von Erinnerungen. Der entscheidende Einwand gegen die Erinnerungen als selbständige Konstituenten der diachronen Identität findet sich jedoch bei Bishop Butler in seinem Aufsatz Of Identity. In einer Replik auf Lockes Theorie der diachronen Identität behauptet er: „And one should really think it self-evident, that consciousness of personal identity presupposes, and therefore cannot constitute, personal identity, any more than knowledge, in any other case, can constitute truth, which it presuppose it.“. (1975, 100). Butler argumentierte für die Seele als Trägerin der personalen Identität, also meint er mit der notwendig vorhergehenden Identität ohne Zweifel die Seele.
Sein Einwand lässt sich nun in folgende Form bringen: Ereigniserinnerung bedeutet soviel wie „Erinnerung an ein eigenes Ereignis“. Ein der eigenen Person zugehöriges Ereignis setzt aber offenbar das Bestehen der personalen Identität bereits voraus und kann somit nicht mehr als ein unabhängiger Konstituent der diachronen Identität der Person fungieren. „Self-evident“ ist der Einwand jedoch nicht. Da Butler seine These nicht argumentativ belegt, dient er nur als allgemeiner Ausgangspunkt für zwei Argumente, warum Ereigniserinnerungen die personale Identität voraussetzen.
(1.) Erinnerungen bedingen, dass etwas Bedeutsames in der Vergangenheit geschehen ist, denn etwas als banal Empfundenes gibt in der Regel keinen Anlass zur Erinnerung. Die Bedeutung eines Originalereignisses ergibt sich jedoch in der Regel erst durch den Bezug auf die eigene Zukunft, welche die diachrone Identität voraussetzt. Verursacht z.B. jemand fahrlässig einen schweren Verkehrsunfall, so ist dies freilich für ihn ein bedeutsames Erlebnis. Und dies ist vor allem deswegen so, da mit dem Verkehrsunfall eine Reihe von Unannehmlichkeiten für seine Zukunft verbunden ist. So rechnet er mit einem Gerichtsverfahren, einem Fahrverbot, einer erheblichen finanziellen Belastung usw. Dabei muss es nicht zu einem expliziten Denken all dieser Folgen kommen; ein gefühlsmäßiges, ungenaues Erfassen der Folgen reicht aus.
Dass eine solche Identifikation mit der eigenen Zukunft stattfindet, lässt sich durch eine Variation dieses Beispiels verdeutlichen. Wenn jemand ebenfalls einen schweren Verkehrsunfall verursacht, aber mit einem gestohlenen Auto, und aus diesem nach Stillstand des Fahrzeuges erfolgreich flüchtet, so ist die Bedeutung des Unfalls für ihn eine wesentlich andere, als wie beim ersten Fall. Die Bedeutsamkeit des Ereignisses ist auch insgesamt geringer und es wird keine Identifikation mit Zukunftsproblemen wie z.B. Strafpunkten in Flensburg geben, sondern höchstens mit der Möglichkeit, später doch noch als Verursacher des Unfalls überführt zu werden.
So sind allgemein ausgedrückt viele Erlebnisse einer Person nicht nur die Erlebnisse einer Person zu einem Zeitpunkt (=synchrone Identität), sondern auch die Erlebnisse der vorweggenommenen diachronen Identität der Person. Es gilt also: wenn sich jemand an ein persönliches Ereignis erinnert, welches durch den Bezug auf die eigene Zukunft mitkonstituiert worden ist, so liegt dieser Erinnerung personale Identität bereits zu Grunde, da die eigene Zukunft selbstverständlich Teil der personalen Identität ist. Da es durch die stark ausgeprägte Zukunftsorientiertheit des Menschen nur wenige Erlebnisse gibt, deren Bedeutung nicht durch den Bezug auf die eigene Zukunft mitbestimmt wird, hat dieser Befund Gewicht. Auf den Punkt gebracht lautet er: das Verhältnis von synchroner zu diachroner Identität der Person ist nicht nur durch eine teilweise Reproduktion von vergangenen Erlebnissen in der gerade aktuellen synchronen Identität geprägt, sondern auch durch die Konstitution von Gehalten der synchronen Identität durch Bezug auf die Vorstellung auf die diachrone Identität.
(2.) Bishop Butlers Einwand, Erinnerungen setzten eine diachrone Identität voraus, so dass sie diese nicht bestimmen könnten, gilt auch in Bezug auf die Reinterpretation vergangener Ereignisse in der Gegenwart des Vorgangs der Erinnerung. Eine potenzielle Erinnerung liegt ja nicht wie ein Datensatz im Gedächtnis vor und muss bloß obskurerweise geöffnet werden, so dass das erinnerte Erlebnis wieder im Bewusstsein ist. Vielmehr unterliegt das Erinnerungspotenzial einer erneuten Bedeutungsgebung, die vom Ursprungserleben ganz unterschieden sein kann. So mag sich jemand an seine frühere Gewohntheit zu rauchen erinnern. Nun ist er Nichtraucher und interpretiert seine damaligen Raucherlebnisse als gesundheitsschädlich, kostspielig und geschmacklos, damals als entspannend oder als puren Genuss (vgl. auch das Beispiel des Diebstahls). Die Bedeutung der Erinnerung ist damit eine andere als die des ihr zugrundeliegenden Ereignisses.
Dies ist ein Beispiel für einen grundsätzlichen Wertewandel. Viel häufiger sind allerdings die situativen Wertewandel. Darunter sind Werte zu verstehen, die in bestimmten Situationen gelten, d.h. sich konkret in Gefühlen, Handlungen und Gedanken zeigen und in anderen Situationen außer Kraft gesetzt sind. Dies gilt z.B. wenn sich jemand in einer Situation sehr lebhaft und ausgelassen verhält, aber in der Erinnerung daran sein Verhalten als unpassend empfindet.
Die Relevanz dieser Bedeutungschangierungen für die diachrone Identität der Person ergibt sich daraus, dass in all diesen Fällen das Originalerlebnis im wesentlichen nicht mehr als solches wiedergegeben wird, da sich seine Bedeutung gewandelt hat. Für die „psychologische Verbundenheit“ als Kriterium für die diachrone Identität und Kontinuität ist es aber von großer Bedeutung, dass ein Erlebnis ohne große Veränderung reproduziert wird, denn ansonsten trägt es nur im geringen Maße zur Kontinuität der Person bei. Wenn sich eine Person dennoch mit einem reinterpretierten Erlebnis identifiziert, sagt dieses nichts über die Identität zwischen Erlebnis und Erinnerung an es aus, da eine Identifikation mit nahezu beliebigen Gehalten stattfinden kann, etwa mit einem Fußballklub, einem Vaterland oder mit politischen Parteien – alles „Gegenstände“, die keinerlei Identität oder Ähnlichkeit mit dem sich mit ihnen Identifizierenden erfordern.
Was bedeuten nun die beiden vorgestellten Einwände für die diachrone Identität der Person? Ereigniserinnerungen fallen als Konstituenten der diachronen Identität in einem streng logischen Sinne aus, da sie diese bereits voraussetzen. Trotzdem bestimmen sie die praktische transtemporale Identität des Menschen und zwar eben nicht auf Basis der Herstellung einer Identität, sondern auf der ineinandergreifender Identifizierungen. Diese unterliegen nicht den rigiden Kriterien logischer Identität, sondern folgen einer eigenen Logik, die wir im Folgenden konkret untersuchen wollen.
Anwendung der Identitätssynthese auf die Bildung von Lebensstimmungen
Sehr viel leichter kann die Problematik unter Hinzuziehung von H. D. Thoreaus autobiographischem Roman Walden (1999) verstanden werden, der im Neuengland der Mitte des 19. Jahrhunderts spielt. Thoreau schildert in Walden den Bau einer kleinen Hütte am Ufer eines Waldsees abseits der Zivilisation. Auf sich alleine gestellt baut er dort zwecks Selbstversorgung Bohnen, Kartoffeln und Rüben an und beschäftigt sich intensiv mit sich selbst, mit der Natur und mit jenen Leuten, die seinen Weg kreuzen. Etwas verkürzt lässt sich dabei sagen, dass Sinn und Zweck seines Lebens sich aus dem Erleben der Natur und seinen geistigen Beschäftigungen speisen.
Ein solches Leben gilt dabei der bürgerlichen Lebensauffassung als ausgesprochen fragwürdig, weil diese nur versteht, was er nicht macht, nämlich nicht Geld zu verdienen, keine Familie zu gründen und kein Amt und Mandat anzustreben, aber nicht, was er macht, nämlich seinen Geist, seinen Körper und seine Wahrnehmung zu kultivieren. Thoreaus Lebensweise befindet sich also in einem scharfen Kontrast zum herrschenden way of life, eine Differenz, die einen Druck auf ihn ausübt, auch so zu werden, wie eben dieser mainstream, und so Zweifel entstehen lässt, ob seine Lebensweise nicht unangemessen oder einfach lächerlich ist.
Wir wollen diesen Druck nicht generell thematisieren und auch nicht die Frage entscheiden, welche Lebensweise angemessener ist, sondern nur untersuchen, auf welche Weise Thoreaus Erinnerungen von diesem beeinflusst werden. Erinnern wir uns dafür kurz an das, was über die Synthese der diachronen Identität der Person festgestellt wurde: das Verhältnis von synchroner zu diachroner Identität der Person ist nicht nur durch eine teilweise Reproduktion von vergangenen Erlebnissen in der gerade aktuellen synchronen Identität geprägt, sondern auch durch die Konstitution von Gehalten der synchronen Identität durch Bezug auf die Vorstellung auf die diachrone Identität. Wenn man sich also fragt, auf welche Weise die Vergangenheit in einer Ereigniserinnerung reaktualisiert wird, stößt man zunächst auf die Konstitution des zu Erinnernden als Originalerlebnis. In dieser Konstitution findet sich u. a. ein Verhältnis von synchroner zu diachroner Identität (zur imaginierten Zukunft), welches in der Erinnerung umgekehrt wird. Das bedeutet nicht bloß die Banalität, dass zu einer Erinnerung etwas gehört, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern auch, dass die Lebensstimmungen zum Zeitpunkt des Originalerlebnisses bereits das später potenziell Erinnerbare bestimmen.
Thoreau macht auf verständliche Weise deutlich, was dies für Stimmungen sind: für einige seiner Besucher ist die Hütte im abseits gelegenen Wald von der Entfernung zur Stadt her geprägt. Die Hütte ist die Peripherie, in der es keine ärztliche Hilfe gibt, die ja in der Stadt ist. Thoreaus Ort erscheint diesen Leuten daher als hoffnungslos verlassen, zumal, da das Urteil, Peripherie zu sein, auch in Bezug auf das Geschäftemachen und die Geselligkeit gilt. „Die große Entfernung von der einen oder anderen Sache“ schlägt sich bei diesen Leuten als Stimmung allgemeinen Unwillens dem Ort gegenüber nieder, eine Stimmung, deren Charakter nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich bestimmt ist, da der Möglichkeitenhorizont etwa der Krankheit und des Geschäfts notwendig auf die Zukunft gerichtet ist. Dieser Horizont schließt Thoreaus Horizont aus, sein Hüttenleben als positiv zu erleben. Thoreau sieht darin entsprechend einen Kampf um das Erleben, in dem seine bürgerlichen Besucher seine Lebensweise nicht gelten lassen wollen: „ (…) all diese Leute sagten gewöhnlich, daß es nicht möglich sei, in meiner Lage viel Gutes auszurichten.“. Seine Besucher interessieren sich nämlich nicht dafür, wie es ihm in seinem Hüttenleben ergeht, wie er sich fühlt und dass er intensiv sein Leben erfährt, sondern sie interessieren sich dafür, dass das Leben in bestimmten Bahnen fungiert, auf dass es zu Prosperität führt. Zwar gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von dieser, aber vor jeder inhaltlichen Bestimmung ist gesetzt, dass im Zweifelsfall der unzufriedene Mensch, der seine Ziele der Prosperität erfüllt, als geglückte Existenz gilt, demgegenüber ein zufriedener Sokrates als eine verunglückte Existenz anzusehen ist. Während Thoreau den zufriedenen Menschen darin ausmacht, dass die Art, wie er seine Arbeit macht, wie er etwas erzählt, wie er isst, schweigt usw., ein Aufgehen in der eigenen Existenz anzeigt, oder eben das Gegenteil davon, wird von seinen Mitbürgern von diesem Wie abgesehen, da ihnen nur das Was im Tun wesentlich erscheint. Thoreau entwickelt also Sympathie für sich selbst und für andere Menschen auf Basis eines nicht materiell bestimmten Sympathievermögens, während seine Besucher weitgehend davon absehen, ob jemand im Daseinsvollzug aufgeht, also eine freudvolle Fülle findet, die von dem objektiven Wert des Gesagten bzw. des Produzierten nicht abhängig ist, sondern gerade auf diesen jeweiligen objektiven Wert abheben und auf Basis dessen Sympathiegefühle entwickeln (Neid, Stolz, Anerkennung usw.). Die Differenz zwischen Thoreau und seinen Mitbürgern besteht also nicht nur darin, dass beide unterschiedliche Werte besitzen, sondern dass Thoreau sein Sympathievermögen letzthin nicht auf eine objektive Liste von Werten und Gütern basiert. Obwohl für ihn z.B. das Studium von Homers Ilias für jeden Menschen verpflichtend sein sollte, der sie verstehen kann, zwingt er niemanden dazu, und findet so auch Gefallen an einem Holzhacker mit sehr schlichtem und zufriedenem Gemüt, der ihn oft besucht.
Thoreaus Problem besteht nun darin, dass er die als objektiv gesetzten Werte nicht erfüllt und daher unter dem Druck eines allgemeinen Sympathieregimes steht, doch auch diese Werte anzustreben, nicht aber in einer Hütte abseits allen als bedeutsam eingeschätzten Geschehens zu leben. Für den Gang unserer Untersuchung ist dabei folgende Feststellung wesentlich: nicht nur steht jedes erinnerte Erlebnis unter dem Zwang, eine Haltung zu ihm einzunehmen, die weniger aus der Souveränität des Individuums folgt, als durch die Haltungen der sozialen Umwelt; bereits das Erleben selbst steht unter diesem Druck, und daher ist der Möglichkeitenhorizont der Erinnerung bereits in der synchronen Identität des Erlebens bestimmt, und zwar durch dessen Schema der diachronen Identität (durch den Bezug auf die eigene Zukunft).
Widersteht Thoreau der sozial bedingten Tendenz zur Inhibition von der Erlebniswerdung, so ist damit derselben Tendenz bezüglich der späteren Erinnerung noch nichts entgegengestellt. Die sozial bedingte Manipulation von Erinnerungen wurde bereits anhand des Diebes erörtert, der sich zwecks Entwicklung von Reue durchaus erinnern soll, jedoch nicht an das Orginalerlebnis des Diebstahls. Denn in diesem findet sich notwendig keine Reue – kaum ein Dieb stiehlt reuevoll. Ziel dieser Manipulation ist es, dass das Verhältnis von synchroner zu diachroner Identität zum Zeitpunkt des Diebstahls das Originalerlebnis in dem Doppelcharakter zu reproduzieren, so dass der Evidenzcharakter bei gleichzeitiger erheblicher Veränderung des Erlebten erhalten bleibt.
Thoreau ist nun einem vergleichbaren Druck der Reinterpretation des von ihm Erlebten ausgesetzt: ist die Hütte in der Erinnerung das, was sie nach den vorherrschenden Werten ist: unkomfortabel, unsicher, weit weg von allem Geschäft und ohne medizinische Versorgung? Ist die Hütte bloß feucht, im Winter schlecht heizbar, also schlicht ungemütlich, oder der Raum, welcher ungestört freies Denken und eine Absetzung vom Zwang zur Erwerbsarbeit erst ermöglicht? Ist die Zeit am Walden bloßer Zeitverlust oder die erfüllte Zeit, die kaum mehr an Fülle übertroffen werden kann? Ist die Beobachtung des Kampfes zweier Ameisenstämme um ein Revier ein bloß interessantes und liebenswürdiges Erlebnis ganz am Rande, oder für die Art Erlebnisse beispielhaft, die man haben möchte?
Dieser Kampf um die Vergangenheit wird wesentlich über die Stimmen ausgetragen. Erinnern wir uns an das, was über das Gewissen gesagt wurde, so ist die Frage „Was hast du in letzter Zeit gemacht?“ eine Gewissensfrage. Man selbst stellt sich die Frage in vielerlei Variationen beständig und andere fragen sie einen ebenso häufig. Der Archetypus dieser Frage ist dabei nicht darauf aus, zu erfahren, was man gemacht habe, sondern was man entsprechend der milieu-spezifischen Lebensagenda gemacht hat. Wird Thoreau nach seinem Tun gefragt, so bezieht sie sich darauf, was er nicht gemacht hat. Die Antworten aus Walden gelten dabei nichts, weil sie der bürgerlichen Agenda des Fragenden nicht entsprechen. Fragt man den Dieb nach seinem Diebstahl, so fragt man nicht nach seinem Erleben, d.h. der positiven Fülle dessen, was er damals erlebt, gehandelt, gedacht, gefühlt hat. Man fragt nicht nach dem, was gewesen ist, sondern nach dem, was an dem Gewesenen gefehlt hat. Man fragt nach der Moralität des Gewesenen, also positiv ausgedrückt nach dem Unrecht, negativ ausgedrückt danach, was dieser Handlungssituation gefehlt hat: die Moral.
Thoreau wird also nicht danach gefragt, was er erlebt hat, sondern was nach dem Standpunkt des Fragenden in seinem Erleben fehlt. Er kann sie nicht durch die Erzählung einiger typischer Erlebnisse von sich beantworten, etwa von dem Duell der Ameisen. Diese Art Erlebnis wird aus bürgerlicher Sicht der Kategorie des Freizeitlebens zugeschlagen, so dass diese Antwort nur auf die Frage, was man sonst macht zu antworten scheint. Gleichzeitig ist sie eine negative Antwort auf die Ausgangsfrage, die auf „Nichts.“ lautet. Man findet in dieser Kategorisierung eine Entwertung von Thoreaus Erlebnissen, weil sie der Kategorie „Sonstiges“ zugeordnet werden und die Hauptkategorie des Beruflichen, des Machens gar nicht belegt wird. Für die meisten Menschen führt Thoreau sein Leben in der Kategorie des Sonstigen, so dass er sein Leben in dieser Sicht größtenteils nicht lebt.
Die Frage „Was machst du?“ bezieht sich auf jene Agenda des Lebens welchen Beruf man hat, was man arbeitet, was man verdient, ob man Familie hat etc. Solchermaßen mutatis mutandis festgelegt, forscht diese Frage bezüglich Thoreaus Leben am Walden genau danach, was er nicht gemacht hat. Ein schwaches Subjekt würde dem Druck der beständigen Fragen dieser Art von anderen und von sich selbst nicht standhalten und selbst zum Ergebnis kommen, viel Zeit verschwendet zu haben. All die Lobpreisungen Thoreaus über seine subsistente Ernährung, seine Welt der Gedanken und seine bereichernde Einsamkeit würden nur von der Seite her gesehen werden, was sie nicht sind: sie sind kein bares Geld wert und man kann darauf keinen positiven sozialen Status gründen. In einem lebenslangen Dialog mit sich und mit anderen wird so die eigene Biographie in den Erinnerungen selbst und in den Lebensstimmungen festgelegt. Die eigene Biographie verarmt dadurch, dass die Fülle des Erlebten (der Originalerlebnisse) durch Anwendung bestimmter Dispositive als Leere bzw. Mangel gesetzt wird. In Anwendung solcher Dispositive kommt es dann zu Erinnerungen, die entwertet sind bzw. kommt es gar nicht mehr zu Erinnerungen, weil das einstmals Erlebte ohne angemessene Dispositive indifferent bleibt. Die fortgesetzte Arbeit der Stimmen in einem Menschen führt in jedem Falle zu einer Entfremdung von seiner Vergangenheit. Entfremdung ist hier jedoch zunächst wertneutral darin zu verstehen, bloß die Differenzbildung zum Gewesenen anzuzeigen, die je nach Maßstab positiv oder negativ bewertet werden kann.
Wie aber gelingt es nun dem literarischen wie echten Thoreau, im Kampf um die Entfremdung vom Erlebten zu bestehen? Er verfügt über bestimmte Dispositive, seine Erinnerungen und noch allgemeiner sein Sprechen mit sich selbst zu organisieren. Die Wurzeln der Idee des Soliloquiums, d.h. die aktive Kultivierung des Sprechens mit sich selbst in Distanzierung zum Sprechen mit und zu anderen, reichen bis in die Antike. Die Skeptiker Phyrrho und Sextus Empiricus wurden bereits diesbezüglich genannt, und die Stoiker sind noch zu nennen.
Hilfs- und Heilsgedanken für den kritischen Lebensfall, Sentenzen und Methoden für die Selbstermahnung und Selbstbescheltung sind für Epiktet, Seneca und Marc Aurel wesentliche Formen der Lebensführung. Charakteristisch für diese elaborierten Soliloquien sind die „griffbereiten“ Sprüche und Sprachfiguren, die in bestimmten Situationen gesagt werden sollen. Im Falle der Prämeditation sagt etwa Epiktet: „Wenn du zu einem Großmächtigen gehst, so stell` dir vor: dass du ihn nicht zu Hause antreffen wirst; dass die Tür dir vor der Nase zugeschlagen werden wird; dass er sich gar nicht um dich kümmern wird. Und wenn es dir zukommt, mit dieser Aussicht hinzugehen, so geh` und nimm es hin, was dir passiert.“ Unter Prämeditation versteht man dabei das Bedenken der Widrigkeiten und Unglücksfälle des Lebens vor ihrem Eintreten, auf dass man von diesen nicht erschüttert werden möge, wenn sie eintreten. Diese Exerzitien des Vordenkens sind zu „Sicherung des inneren Lebens“ angedacht“, wie Paul Rabbow in seiner Übersicht über Grundformen und -praktiken der antiken Selbstführung schreibt: „Man muß sich vorstellen, dass die praemeditativen Übungen in der Stoa (…) mit höchster Intensität, täglich, andauernd vorgenommen wurden; und daß sie eine Totalität hatten, die jede auch nur irgendwie erdenkliche Möglichkeit des Unheils, auch die außerhalb der Erfahrung liegende, der Seele bis ins innerste Lebensmark eindringlich machten.“ Zu dieser Arbeit an sich selbst gehörten auch die Selbstprüfungen, von der Seneca in De ira sagt: „Gibt es denn etwas Schöneres als die Gewohnheit, seinen ganzen Tag so durch und durch zu prüfen? Wie ruhig ist der Schlaf, wie tief und frei, der auf die Selbstmusterung folgt! Täglich verantworte ich mich vor meinem Richterstuhl!“ In einem solchen Soliloquium wird das Vorgefallene des vergangenen Tages (oder eines längeren Zeitraumes) bedacht, gegebenenfalls gescholten oder gelobt. Sofern sich das Gespräch mit sich selbst auf die Zukunft bezieht, fließen auch Ermahnungen, Vorgaben und Pläne mit ein.
Die menschliche Existenz ist dabei dem Stoiker entweder in ihrem Sein notwendig im Sinne des Unabänderlichen oder aber aus Sicht des betreffenden Menschen durch Handlungen gestaltbar. Durch eine, je nach stoischem Autor veränderliche, spezifische Bestimmung dessen, was in der Macht des Menschen steht und was nicht, wird bestimmt, was als unabänderlich ohne Klagen und Vorwürfe hinzunehmen ist und was durch weises Verhalten aktiv bestimmt werden kann.
Während bestimmte Formen des Leidens, wie die des ungestillten Hungers etwa, hinzunehmen sind, gelten andere Weisen des Unglücks als gestaltbar. Der allgemeine Grund der Gestaltbarkeit liegt darin, dass Affekte als Urteile aufgefasst werden, demnach bestimmte, falsche Urteile Leiden hervorrufen. In diesem Sinne rät Epiktet im Handbüchlein der Moral:
„Bestrebe dich, jeder unangenehmen Vorstellung sofort zu begegnen mit den Worten: du bist nur eine Vorstellung, und durchaus nicht das, als was du erscheinst. Alsdann untersuche dieselbe, und prüfe sie nach den Regeln, welche du hast, und zwar zuerst und allermeist nach der, ob es etwas betrifft, was in unserer Gewalt ist, oder etwas, das nicht in unserer Gewalt ist; und wenn es etwas betrifft, das nicht in unserer Gewalt ist, so sprich nur jedesmal sogleich: Geht mich nichts an!“ (1921:20)
In diesem Sinne ist der Hunger zu einem Teil etwas Hinzunehmendes, nämlich als unmittelbarer, leiblicher Mangel, zu einem Teil etwas aus den Vorstellungen resultierendes Leiden, so z.B., wenn man etwa jemanden Vorwürfe darüber macht, dass er es versäumt hat, Nahrungsmittel zu besorgen. Auch die Todesangst ist etwas, was einem falschen Urteil entspringt. Epiktet rät:
„Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen. So ist z.B. der Tod nichts Schreckliches, sonst wäre er auch dem Sokrates so erschienen; sondern die Meinung von dem Tod, daß er etwas Schreckliches sei, das ist das Schreckliche. Wenn wir nun auf Hindernisse stoßen, oder beunruhigt, oder bekümmert sind, so wollen wir niemals einen andern anklagen, sondern uns selbst, das heißt: unsere eigenen Meinungen. – Sache des Unwissenden ist es, andere wegen seines Mißgeschicks anzuklagen; Sache des Anfängers in der Weisheit, sich selbst anzuklagen; Sache des Weisen, weder einen andern, noch sich selbst anzuklagen.“ (1921:20)
Kritisch ist dabei die Setzung des Notwendigen zu sehen: die Notwendigkeit der Stoiker ist von der Natur der Dinge bzw. jener der Urteile über sie bestimmt. Eine Distinktion der Notwendigkeit auf den beiden Ebenen des Phänomens, dessen Was und dem Wie des Gegebenseins dieses Was, wird dagegen nicht vollzogen. Daher ist auch der Gedanke der Notwendigkeit des Sich-Befindens, also der Manifestation als solcher, nicht gedacht. Die Vorstellung um der Vorstellung willen, genauer um das Sich-Manifestieren willen, wird gerade nicht beachtet. Denn dieser Notwendigkeit der Manifestation kann nicht in dem Erkennen der Natur von etwas bestimmt werden, weil das Wesen des Sich-Erscheinens wie erörtert grundsätzlich nicht erkannt werden kann. Vielmehr ist es gerade die Pointe von Novalis` Sprachauffassung, dass sich das ankünftige Sein des Sprechens bemächtigt, um sich effektiv zu phänomenalisieren.
Kritisch ist auch die Setzung des Leidens als Leiden aufgrund eines Urteils zu sehen. Im Besonderen fällt dabei im Rahmen unserer Untersuchung nicht die ungewöhnliche Behauptung, Affekte seien Urteile, als kritikwürdig auf, sondern die damit verbundene Entäußerung des Leidens ist es, die problematisch ist, weil in dieser der Bezug des je konkreten Leidens auf sich selbst aus den Augen verloren wird. D.h. die Pointe von Nietzsches Amor fati, wonach im Leiden Selbstmächtigkeit notwendig gegeben sein muss, damit es überhaupt Leiden sein kann, entgeht dem Stoiker. Leiden ist nach Nietzsche und nach seinem Interpretanten Michel Henry gerade aufgrund seiner Phänomenalisierung, die sich in der Selbstaffektion findet, in seinem Charakter niemals notwendig Leiden, sondern modalisierbar, nämlich in einem Sich-Erfreuen (Henry) bzw. einem Erfahren von sich als Macht (Nietzsche).
Während für die Stoa das Was im Gegebenen bestimmt, was notwendig ist und was nicht, zeichnet sich in Novalis` Ironie eine Bestimmung durch das Was und durch sein Gegebensein als Selbstgefühl aus. Dadurch ergibt sich ein anderer Horizont: was sich uns mitteilt bzw. aufdrängt, ist nicht primär vom Sich-Aufdrängenden her zu verstehen, sondern von dem her, was dessen Manifestation ermöglicht. Insofern dieses, verstanden als Pathos, selbst ein Zwang darin ist, sich manifestieren zu müssen, liegt es nahe, das Was, in dem es sich als das Notwendige manifestiert, selbst anzusehen. Geht man aber von der ontologischen Vorgängigkeit des Wie des Gegebenseins aus, so impliziert Novalis` Gedankengang, dass in der Erprobung des Wie in der Mannigfaltigkeit des Was ein potenziell unendlicher Horizont an Möglichkeiten gegeben ist.
Thoreau nun, der von solchen theoretischen Überlegungen kaum gestreift wurde, vermag es, anhand der Erinnerung die „Doppelung“ von Notwendigkeit im Sinne des Noetischen und Noematischen anhand der Ereigniserinnerungen praktisch zu illustrieren. Denn er widersteht dem Druck auf die eigene Biographie nicht nur, sondern wendet ihn von sich aus an. Er befragt das Verhalten anderer Menschen ebenso von dem her, was es nicht ist und nicht, was es ist. Dadurch wird es ihm überhaupt erst zum Erlebnis.
Die dargestellte innere Dynamik der Frage Was machst du? nutzt Thoreau in seinem Sinne, das Verhalten anderer zum Erlebnis werden zu lassen. Er erinnert sich entsprechend nicht daran, was jemand einmal gesagt oder getan hat, sondern vorzugsweise an das, was in diesem Sagen bzw. Tun gefehlt hat. Wenn er sich an Menschen erinnert, die „zu einem ganz fest entschlossen sind, nämlich sich selbst nicht zu helfen.“, so erinnert er sich gerade nicht an das, was so ein Mensch gesagt hat, nämlich, dass er von ganzem Herzen wünsche, dass ihm geholfen mögen werde.
Es ist dabei für die Erlebnisqualitäten der Erinnerung sekundär, ob Thoreau sich den Hintergrund des Gesagten erfindet oder treffend erfasst. In erster Linie geht es um die Dispositive, die jemand besitzt, um Erinnerungen in sich zu realisieren. Seine philosophischen Ideen sind in der Regel solche Dispositive der Erinnerung, was für den Typus des Denkers ungewöhnlich ist, weil bei ihm Ideen meist in Relation zu anderen Ideen auf derselben Abstraktionsebene stehen. Die Ideen werden auf philologischer, historischer und systematischer Ebene miteinander in Verbindung gebracht und bilden auf diese Weise einen in sich geschlossenen Horizont. Thoreau ist nicht dieser Typ des analytischen Denkers, sondern verbindet lebensweltliche Horizonte mit solchen theoretischer Art. Seine Dispositive der Erinnerung stehen dabei nicht einer Erinnerungspraxis gegenüber, in der man sich unreflektiert erinnert, weil jede Erinnerung ein Dispositiv benötigt, und entsprechend jeder Mensch über solche verfügt. Thoreau hat sich dieser Praxis bemächtigt, indem er eine große Anzahl Dispositive in Absetzung zu den sozial dominierenden Dispositiven entwickelt hat, so dass er jene Virtuosität in der Praxis erreicht hat, von der Friedrich Schlegel und Novalis im Rahmen der rezessiven und produktiven Ironie gesprochen haben. Dabei ist zu beachten, dass das Originalerlebnis bereits nur durch ein Dispositiv überhaupt verwirklicht werden kann. In der Erinnerung an es wird dann ein zweites Dispositiv zur Anwendung gebracht, welches mit dem ersten übereinstimmen kann, aber nicht muss. Unabhängig davon, ob eine Ereigniserinnerung ausgesprochen funktionalen Charakter hat oder nicht, gilt für jede solche dieser Zwang zum Doppeldispositiv. M. a. W. sprechen wir hier nicht über den Lebenskünstler, sondern über den Menschen Thoreau, der wie alle anderen diesem Zwang unterliegt, ihn aber nicht naturalisiert, sondern aktiv gestaltet.
Ein solches „Doppeldispositiv“ ist noch einmal zur näheren Illustration zu betrachten, insbesondere um das Ereignisdenken der Stoa zu revidieren. Die Bildung einer Lebensstimmung ist im Kern das Resultat dessen, was jemand an Leere, Enttäuschung, Fülle etc. erlebt hat. Solch eine Lebensstimmung ist dabei nicht nur als etwas distinkt Historisches anzusehen, sondern allgemeiner als Element des Selbstgefühls. In diesem Sinne haben wir die Boshaftigkeit untersucht, die Teil der Lebensstimmung auf Basis konkret ausgeübter Boshaftigkeiten in protentionaler Hinsicht ist. Dabei zeigte sich, dass die Neigung zum Boshaften als Eigenschaft eines Menschen alleine nicht ausreicht, Teil des Selbstgefühls zu werden, da diese Neigung auch eine Geschichte konkreter Anwendungen zur stimmungsmäßigen Artikulation benötigt. Eine solche Artikulation ist im Sinne der passiven Synthesen als aktive Artikulation anzusehen, im Falle der Boshaftigkeit z.B. darin, die äußere Wahrnehmung durch einen leerintentionalen Horizont zu durchdringen.
Die Figur des Henry David Thoreau nun möchte sich nicht nur der Kultivierung seiner Stimmen, hier jener der Ereigniserinnerungen, versichern, sondern auch das Selbstgefühl auf Basis seiner Vergangenheit kultivieren. Sich zu erinnern ist demnach keineswegs nur durch distinkte Erinnerungen bestimmt, sondern auch durch die Bildung von stimmungsmäßigen Präsenzen der eigenen Biographie. Soll nun die Eigenschaft Thoreaus, sich gerne und häufig in der Natur aufzuhalten, dort regelrechte Exkursionen durchzuführen, zum Selbstgefühl positiv beitragen, so zeigt sich zunächst das bereits besprochene Problem des irreversiblen Verlustes der lebendigen Gegenwart – ist eine Exkursion vorbei, so lässt sie sich nicht in der Vorstellung reaktualisieren. Diese natürliche Tendenz zur Irrealisierung der eigenen Vergangenheit trifft auf die gesellschaftlich angeleitete Irrealisierung solcher Praktiken wie Spaziergänge in der Natur, die außerhalb bestimmter Anlässe wie dem Weihnachtsspaziergang als unwesentlich angesehen werden. Der Spaziergang ist als mögliche, aber nicht notwendige Ergänzung zum tätigen Leben anerkannt. Er gilt als Freizeitbeschäftigung, was u.a. impliziert, dass ein Mensch ohne tätiges Leben, der nach den gerade gültigen gesellschaftlichen Normen tätig sein sollte, im Spazierengehen reinen Müßiggang betreibt. Spricht man dem Aufenthalt in der Natur dabei auch noch so intensiv wie Thoreau zu, gilt dieses Engagement als Flucht vor den Pflichten des erwachsenen Menschen, insofern ein Leben bürgerlicher Tugenden nicht gelebt werden kann, wenn sich ein Mensch jeden Tag viele Stunden sich in Feld und Wald aufhält.
Um nicht dieser sozial angeleiteten Ansicht anheimzufallen, ist es notwendig, ein Spiel von Gewinn und Verlust durchzuführen, wie wir dies in Anlehnung an Husserl mit den Raumstimmungen bereits durchgeführt haben. Als Verlust galt dort das Vergehen der Anschauung in der äußeren Wahrnehmung, als Gewinn u.a. die Erweiterung des Wahrnehmungshabitus` und die Bildung von retentionalen Reihen, welche sich u. U. zu bestimmten persistenten Stimmungen verdichten können. Ein Berufsspaziergänger wie Thoreau findet nun die Situation vor, dass seine Naturerlebnisse, und seien sie auch noch so erfüllend, ihre Fülle im Blick zurück auf die eigenen Vergangenheit verlieren, und dass die sozial dominierende Einstellung zu solchen Erlebnissen tendenziell durch ein Herabsetzen zur Null gekennzeichnet ist. Was er also hat, sind zwei Irrealisierungstendenzen dem Erlebten gegenüber. Er hat aber noch etwas, nämlich eine Erweiterung seines sprachlichen Habitus` in Hinblick auf das Erlebte. Zwar ist es ihm nicht möglich, das Erlebte bloß in Worte zu fassen, es unter Verwendung von Adjektiven wie „schön“, „einmalig“ usw. wieder zum Leben zu erwecken, aber er kann die Negation des Naturerlebens gemäß des bürgerlichen Lebenssinns in der Differenz zu seinen eigenen Erlebnissen zum Ausdruck bringen. Durch eine solche Differenz wird eine Urteilsserie vollzogen, die nicht primär dem Feststellen von Tatsachen dient, sondern der Gegenverwirklichung des Ausgedrückten als Pathos. Anders ausgedrückt geht es wie beim Moralisieren nicht um das Noematische, sondern um das Noetische.
Eine solche Differenzbildung kann nun etwa folgende Form annehmen: der Mensch mit bürgerlichen Arbeitstugenden bewegt sich durch eine Landschaft, ohne diese jemals betreten zu können. Dieser Verlust der Breitendimension ist darauf zurückzuführen, dass die einzig mögliche Bewegungsrichtung jene ist, nach vorwärts zu gehen bzw. zu fahren, um an das ausgegebene Ziel zu gelangen. Einen kurzen Abstecher zu unternehmen, würde bedeuten, seinem Ziel nicht mehr näher zu kommen, was dem Sinn der Reise überhaupt widerspräche. Auch wäre rückwärts zu gehen keine Option, da dies schlicht bedeutete, umzukehren. Das Straßen- und Wegenetz schafft sich so für den Handlungsreisenden einen autonomen und homogenen Raum, in welchem die Landschaft bewältigtes Hindernis wird. Die Landschaft wird zu einem zu durchquerenden Leerraum, der selbst außerhalb der Straßen und Städte so gut wie nie betreten wird, weil ein solches Betreten sinnlos ist.
Der Horizont solcher Menschen ist entsprechend beschränkt und das sprachliche Nachvollziehen eines solchen beschränkten Horizontes hat nun den Sinn, in der Differenzbildung zum eigenen Horizont als passionierter Naturgänger, diese einem zukommende Eigenschaft thematisch werden zu lassen. Solche Differenzbildungen muten harmlos an und scheinen im besten Falle den Reiz einer geglückten essayistischen Betrachtung besitzen zu können. Sie sind aber mehr, da es nicht bloß darum geht, sich selbst etwas Unterhaltsames zu erzählen, sondern einen Aspekt seines Selbstgefühls zu kultivieren. Denn das Gefühl, man selbst zu sein, basiert wesentlich auf dem einem zukommenden Fähigkeiten, sich auf sich bzw. auf die Welt spezifisch beziehen zu können und in diesem Bezug Sinneinheiten zu bilden, in welchen ein freudvolles Sich-Erleben möglich ist. Das einem als Menschen spezifisch auszeichnende Selbstgefühl wird dabei so aktualisiert, sich in der Erscheinungsform der Stimmung thematisch, nicht aber auf spezifische Einzelerlebnisse bezogen, zu erinnern. Im Selbstgefühl aktualisiert man es also, jemand zu sein, d.h. mit bestimmten Fähigkeiten, Vermögen und Unvermögen ausgestattet zu sein.
In dieser Hinsicht steht bei Thoreau nun einiges auf dem Spiel, da seine Fähigkeit, im Naturerleben das ihm ankünftige Sein freudvoll zu realisieren, den dargelegten Irrealisierungstendenzen anheimzufallen droht. Trägt diese Fähigkeit der positiven Weltbegegnung dazu bei, ein positives Selbstgefühl auszubilden oder trägt es umgekehrt als „Unfähigkeit“ dazu bei als Ausdruck des verpassten Lebens des tätigen Menschen sich selbst als unvermögenden Menschen zu erleben? Es geht also darum, nicht um ein Teil seiner selbst erleichtert zu werden, bzw. darum, diesen Teil nicht als Bürde, nämlich als im Selbstgefühl dauerpräsentes Unvermögen zu erleben.
Während es aber schwer fällt, die Wirkungen solcher Thematisierungen als entscheidend für die Bestimmung der verschiedenen Formen der Erinnerung (Stimmen der Ereigniserinnerung, Lebensstimmungen, protentionale „Erinnerung“) anzuerkennen, ist es viel eher einsichtig, das negative Gegenstück dazu darzustellen.
So wie der bekehrte Raucher seine Erinnerungen an sein Rauchen ohne jede Beirrung verfälscht und der geläuterte Dieb konterfaktische Elemente mit solchen des Originalerlebens zu einer als authentisch erlebten Ereigniserinnerung synthetisiert, so lässt sich auch jener Thoreau darstellen, der sich an den sozial vorgegebenen Welthorizont bindet und so seine Biographie zu Teilen entwertet, weil er diesem Horizont nicht entspricht. Insofern es den Menschen auszeichnet, sich beständig auf seine Zukunft hin zu entwerfen, sind dessen spezifische Eigenschaften nicht nur als potenzielle Formen der Welt- und Selbsterschließung von Belang, sondern auch als protentional sich beständig in einem Leerhorizont aktualisierende Aspekte seines Daseins. Eine persönliche Eigenschaft nimmt sich dann in der Bildung eines solchen Horizontes in gewisser Weise vorweg und bildet ein passiv-doxischs Feld. Solche protentionale Verwirklichungen sind Ausdruck eines bestimmten Lebensvertrauens, welches in der thematischen Setzung von Zukunftserwartungen besteht. Dabei bedeutet Vertrauen zunächst nur soviel wie Zukunftserwartung überhaupt, und kann also auch negative Vorwegnahmen der Zukunft beinhalten. Erst wenn keinerlei Vorwegnahmen stattfinden kann man von einem fehlenden Lebensvertrauen protentionaler Art sprechen.
Dabei findet eine negative Ausrichtung dieses Lebensvertrauens dann statt, wenn das Empfangen des Lebens als Teilnahme an einen bestimmten Welthorizont gebunden wird, aber das, was in diesem Horizont an Gütern gesetzt ist, nicht erreicht werden kann. Das Problematische an dieser vorontologischen Einstellung besteht dabei nicht nur in der spezifischen Benennung der positiven und negativen Güter, sondern auch in der dieser „Liste“ zugrundeliegenden Idee, Dasein resultiere aus einem Außen. Demnach nimmt man an Dasein insoweit Teil, wie der jeweilig bestimmte Horizont des Außen einem Dasein zukommen lässt und nimmt in dem Maße nicht daran Teil, wie man sich nicht des Daseins in diesem Außen versichern kann.
Die Ankünftigkeit des Daseins ist jedoch nicht eine solche, die sich einem Außen verdanken könnte, sondern findet sich in dem passiven Empfangen von Affektivität, welches selbstaffektiv Dasein als Sich-Rezipieren erst ermöglicht. Diese abstrakte Ankünftigkeit des Daseins trifft dabei auf eine konkrete Ankünftigkeit des Daseins, die beständig in der Bildung eines passiv-doxischen Feldes der eigenen Zukunft vorgenommen wird. Insofern dieses Feld passiv bestimmt wird, d.h. unter Ausschluss des wachen Ich als Synthesen, die den protentionalen Leerhorizont aus einem Fundus erworbener Formen passiver Synthesen speisen, gibt sich im Fungieren das ankünftige Dasein in der Figur des Thoreau in der Form eines negativen Lebensvertrauens. Diese Negativität bedeutet ein Leiden an sich selbst, insofern das ankünftig wird, was sich ihm nicht geben wird, da er mit seinen Selbst- und Welterschließungsformen am Welthorizont nicht teilnehmen kann, aber in diesem Nichts sich dennoch als Stimmung des Überflüssigseins, der Leere, des Selbstzweifels etc. phänomenalisiert.
Urform der scheiternden Vorwegnahme der eigenen Zukunft ist die Angst vor dem eigenen Tod: ein unbegrenztes Fortdauern der eigenen Existenz wird leerintentional vermeint, aber sogleich enttäuscht, insofern in diesem Horizont der Tod notwendig auftreten wird. Spricht Epikur dabei von dem Schatten des Todes, so ist dieser Ausdruck mehr als eine Metapher, insofern es tatsächlich zu einer Durchdringung der ganzen Existenz kommt, welche einer Verschattung entspricht.
Der Entwurf in die Zukunft ewigen Lebens entwertet sich allgemein gesprochen dabei in den passiven Synthesen dadurch, dass es in diesen arbeitet, indem es zu einer Setzung kommt, die sogleich negiert wird, weil ein Bezug des Gesetzten zum Horizont, in dem es gesetzt ist, hergestellt wird, auf dass die Unmöglichkeit einer Erfüllung des Intendierten in dem Horizont vorgezeichnet wird. Diese Entwertung des Entwurfes ist dabei als Entwertung phänomenalisiert, also keineswegs inexistent, sondern als Furcht, Angst, Hoffnungslosigkeit usw. positiv bestimmt. Die eigene Zukunft des passiv-doxischen Feldes muss sich allerdings keineswegs immer anhand der Todesproblematik entwerten, sondern kann auch in sehr viel kleineren Negationen bestehen. Immer dann, wenn sich ein Mensch an einen Horizont bindet, dessen Güter für ihn nicht erreichbar sind, wird er seinen protentionalen Horizont als Enttäuschung realisieren. Im Falle Thoreaus bestünde das Problem darin, dass seine Lebensform unmöglich das erbringen wird, was dem Horizont des mainstream nach erbracht werden muss, um eine Zukunft zu haben. Bindet sich Thoreau an diesen Horizont, so wird das ihm ankünftige Sein zu einer Last, weil es sich im Vorgriff selbst entwertet.
Sebastian Knöpker