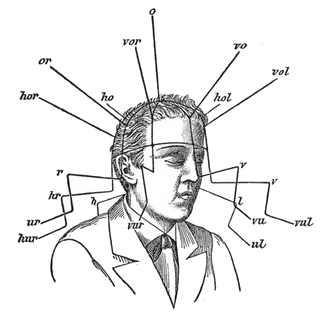Für die akademische Phänomenologie braucht man weder besondere Fähigkeiten, noch entwickelt man in der Arbeit mit ihr welche. Das liegt an einer strengen Abneigung gegen jedes Handwerk von Anschauung und Denken. Deskriptive Phänomenologie braucht aber so ein handwerkliches Geschick, sonst wird es mit der Beschreibung nichts.
Für die akademische Phänomenologie braucht man weder besondere Fähigkeiten, noch entwickelt man in der Arbeit mit ihr welche. Das liegt an einer strengen Abneigung gegen jedes Handwerk von Anschauung und Denken. Deskriptive Phänomenologie braucht aber so ein handwerkliches Geschick, sonst wird es mit der Beschreibung nichts.
Die Phänomenologie als Handwerk erlernt man nur über den Umweg eines echten Handwerkes. Das seemännische Knoten ist so eine Praxis, die zum phänomenologischen Handwerk führt. Das Hantieren mit dem Seil ermöglicht einen Einstieg in die Phänomenologie.
Und der sieht so aus: möchte ich zwei gleich starke Seile miteinander verbinden, kann ich einen Kreuzknoten knüpfen, der eigentlich nur darin besteht, zwei gewöhnliche Haushaltsknoten aufeinander folgen zu lassen. Das Phänomenologische besteht dabei darin, dass man die beiden Seele mit dem losen Ende übereinander legt und dabei mehr sieht als man eigentlich sehen kann.
Denn das eine Seil verdeckt das andere, doch geht das überdeckte Teil des Seils hinter dem sichtbaren Seil in der eigenen Wahrnehmung weiter. Der verdeckte Teil ist eben nicht mehr zu sehen, doch im Hinschauen auf die beiden mit einem einfachen Haushaltsknoten verbundenen Seile „sieht“ man ihn dennoch. So gibt es eine Unterdeckung der Anschaulichkeit: beim Knoten sehe ich das, was nicht sichtbar ist.
Was ich dabei beschreibe, überschreitet also das Anschauliche. Darauf komme ich, wenn ich eine ganze Serie von Phänomenen miteinander vergleiche, also beide Seile drehe, wende, von allen Seiten sehe wie betaste und die soeben vergangenen Ansichten im mentalen Griff behalte.
Der Tastsinn bildet dabei eine besondere Einheit mit den Bewegungen, die dem aufmerksamen Beobachter ebenfalls verrät, dass es eine Unterdeckung von Abschattung des Gegenstandes zu Vollding gibt.
Das zeigt sich beim Kreuzknoten, bei dem zwei handelsübliche Knoten wie beim Schnüren eines Schuhbändels aufeinanderfolgen. Doch ist hier ein Detail zu beachten: die beiden Seile, die den ersten Knoten ergeben, müssen den zweiten Knoten so bilden, dass das Seil, das verdeckt wird beim zweiten Knoten wieder vom verdeckenden Seil verdeckt wird. Ist das nicht der Fall, hält der Knoten nicht. Die Bewegungen des Knotens führen diese Zuordnung aus, indem sie ebenfalls von durchgehenden Gegenständen durch alle unterschiedlichen Abschattungen hindurch ausgehen. D.h. das Knotenhandwerk als Serie zielgerichteter Bewegungen schafft sich ebenfalls Vollgegenstände in Unterdeckung. Wäre das nicht so, könnten sie nur zufällig einen Kreuzknoten hervorbringen.
Phänomenologisch ist daran der Vergleich der Abschattungen der beiden Seile miteinander, der in einer Schlussfolgerung mündet: was ich sehe und ertaste ist immer nur ein kleiner Teil des vollen Gegenstandes und dennoch habe ich die Gewissheit, die ganzen Seile, die kompletten Gegenstände wahrzunehmen. Die vergleichende Beschreibung als Synthese von Sehen, Tasten und Bewegung erfasst somit das, was nicht gesehen wird und nie gesehen werden kann.
Deskriptive Phänomenologie heißt also, eine Serie von Phänomenen miteinander zu vergleichen und in dieser Synthese zu einem Widerspruch zu kommen, der hier darin besteht, dass der Vollgegenstand erlebt wird, doch nur eine Teilansicht von ihm anschaulich gegeben ist. Genau hinschauen reicht also in der Deskription nicht, da nur durch das Zurückhalten von Ansichten und deren analytischen Vergleich untereinander das Unsichtbare beschrieben werden kann.
Im nächsten Schritt wird diese Beschreibung auf alle Gegenstände in der Außenwahrnehmung übertragen, wo sich ebenfalls eine Unterdeckung zeigt. Mit diesem generalisierten Urteil bildet sich ein Begriff heraus, den man intentionalen Gegenstand nennen kann. Demnach gilt: etwas wird als etwas aufgefasst – Sinneseindrücke werden zu Gegenständen konstituiert. Diese Gegenstände sind Leistungen des wahrnehmenden Subjektes, die kein Medium der Anschauung besitzen, also weder gehört, ertastet, gesehen etc. werden. Im rohen Dasein der sinnlichen Eindrücke gibt es entsprechend einen ideellen Gehalt.
Was man davon hat? Man kann das beschreiben, was niemand sieht und niemand je sehen können wird. Das führt zu abstrakten Begriffen, die wiederum komplexere Beschreibungen ermöglichen.
Praktisch wird das im Schmecken, wo Geschmacksbilder einander überlagern, aber so wie bei den Seilen einander keineswegs auslöschen, sondern durch die Abschattungen hindurch ihre volle Identität erhalten.
Bei einem guten Bordeaux werden verschiedene Weine miteinander vermischt, deren jeweiliges Geschmacksbild für den Weinkenner sich jeweils erhalten, obwohl sie gar nicht sinnlich geschmeckt werden können. Besteht die Assemblage etwa aus drei einzeln ausgebauten Weinen auf Basis von je einer einzigen Rebsorte (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc), verschwimmt der jeweilige Einzelgeschmack für den geübten Weintrinker nicht, sondern geht im „verdeckten Teil“ weiter, weil der Trinker diese Geschmacksbilder kennt und aus seinem Vorrat an Erfahrungen dem aktuellen Geschmackserlebnis hinzufügt.
Fehlt diese Hinzufügung (Apperzeption), so gibt es bloß lauter Abschattungen, aber nicht die dazu gehörigen Vollgeschmacksmuster, so dass der Eindruck vom Bordeaux lediglich einigermaßen angenehm sein wird. Der Bordeauxgenuss hängt also phänomenologisch betrachtet vom trinkenden Subjekt wesentlich ab, das einmal gemachte Erfahrungen reaktiviert und in den gegenwärtige Geschmackseindruck mit einbringt.
Sebastian Knöpker