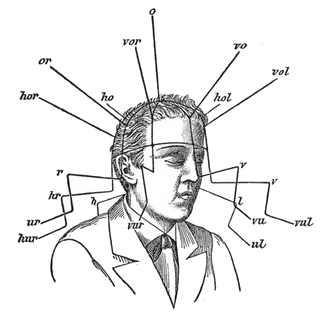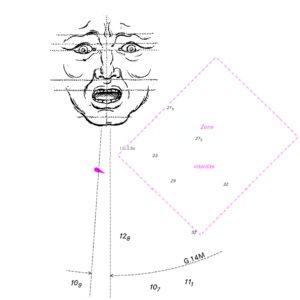
Bei einer Hochwasserkatastrophe stehen Moderatoren in voller Montur oft bis zu den Knien im Wasser. Damit soll der Mangel behoben werden, dass Wasser aus der Entfernung kaum nass wirkt. Die Phänomenologie des Nassen fordert aber entschieden mehr als nasse Schuhe …
Das Problem: Wasser im Fernsehen oder auf der Leinwand wird oft nur als nass erkannt, aber nicht als nass empfunden. Echte maritime Kunst besteht entsprechend darin, dass Sehen und leibliches Fühlen des Feuchten eine Einheit bilden. Ein Bild vom Seegang auf dem Meer ist also nur dann gut, wenn das Nasskalte auch leiblich mitempfunden wird. In dem Sinne durchnässen die Maler Anton Melbye (1818-1875) und Jeremy Miranda (* 1980) effektiv ihre Bilder.
Auch in der erzählenden Literatur wirken die meisten Wasserszenen noch nicht einmal feucht, geschweige denn nass. Es wird viel vom Wasser erzählt, nur dass es beim Leser nie so richtig ankommt. Also fehlt es an der apperzeptiven Einheit von begrifflichem Verstehen und leiblicher Reaktion aus sicherer Entfernung zum Wasser. Was zunächst nur Begriff ist, soll auch leiblich miterlebt werden. Lesen als Sehen und Verstehen müssen entsprechend auch ein haptisches Fühlen mitauslösen, soll das Ganze Nass wirken.
Wird eine Bergwanderung beschrieben und steigt der Wanderer dabei in eine Wolke.m ist sie „kaum mehr als eine sachte Berührung auf der Haut, klamm oder bloß kühl.“ Zudem ist ist die „Wolke ist nass, aber nicht durchnässend“ wie die Autorin Anna Shepard (1893-1981) ihre Leser in Der lebende Berg (1977) wissen lässt. Das erzeugt einen erfreulich nasse Effekt beim Lesen, obwohl nur Kondenswasser beschrieben wird.
Der subtile Reiz der ästhetischen Vermittlung des Nassen besteht darin, dass aus der Biographie des Lesers konkrete Erfahrungen des Nassen, die schon lange zurück liegen, auf halbem Weg wiedererweckt werden. Man fühlt dabei das leiblich, was man einmal empfunden hat, und es handelt sich dabei um eine abstrakt-leibliche Empfindung, da ja kein realer Wasserkontakt da ist.
Zwar wäre es deutlich „nasser“, wenn man selbst im kalten November in den Rhein steigen würde, doch diese gesteigerte Erfahrung des Nassen kann nicht konkurrieren mit der ästhetischen Anhauchung, dass der haptische Sinn als sachtes Phantasma beim Lesen mitgeweckt wird.
Die Ästhetik des Nassen besteht also darin, dass beim Sehen oder im Lesen das gegebene Medium einen haptischen Mehrwert erhält, der eine eigenständige Kategorie der Erfahrung mit sich bringt, die außerhalb der Kunst auch bei noch so viel Kontakt mit den verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers nicht zu haben ist. Die Einheit von Sehen, Erkennen und leiblichem Fühlen bei unmittelbarer Abwesenheit des Dargestellten bildet also ein entscheidende Kriterium dafür, was Kunst ist.
Sebastian Knöpker