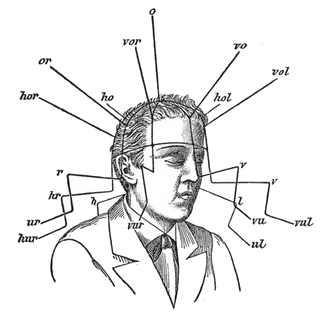Die Philosophie Henrys begreift sich als Phänomenologie, welche sowohl an die Phänomenologie in der Folge Husserls anknüpft als auch den Anspruch hat, diese zu revolutionieren. Henry gehört damit in eine lange Reihe der Husserlhäretiker, beginnend mit Scheler, Heidegger, Sartre über Merleau-Ponty, Lévinas bis hin zu Ricœur und Derrida. All diese Denker nahmen ihren Ausgang von der klassischen Phänomenologie Husserls, um sich in der Folge von ihr abzuwenden und die orthodoxe Phänomenologie gegen den Strich zu kämmen. Henry hat dabei im Speziellen den Anspruch, nicht über die Phänomenologie hinauszugehen, sondern innerhalb von ihr eine Horizonterweiterung vorzunehmen, welche sie neu begründet. Im Folgenden gehen wir daher der Frage nach, ob er diesem Anspruch gerecht wird.
Der Gegenstand der Phänomenologie ist die Weise der Erscheinung von Phänomenen, was zur Folge hat, dass sie sich nicht wie die Geographie oder die Chemie auf einen bestimmten Ausschnitt der Welt bezieht. Ihr Gegenstand ist gerade vom konkreten Erscheinungsgehalt jedes Phänomens unterschieden, insofern die Weise der Erscheinung eines Phänomens nicht mit seinem Erscheinungsgehalt zusammenfällt. Die Phänomenologie zeichnet es von daher aus, in der Unterscheidung zwischen der Erscheinungsweise des Phänomens und seinem Erscheinungsgehalt keinen konkreten Untersuchungsgegenstand zu besitzen. Weiter ist es für die Phänomenologie zentral, das Phänomen als je in Akten hervorgebracht zu begreifen und nicht als ein Seiendes, welches in einem nicht weiter zu hinterfragenden Sinne schlicht vorhanden ist. Entsprechend wird zwischen dem Akt und dem Inhalt eines Phänomens unterschieden, eine Unterscheidung, die eng mit der Distinktion von Erscheinungsgehalt und Erscheinungsweise des Phänomens zusammenhängt. Die genannten Distinktionen finden ihren Niederschlag in der Unterscheidung von Noema als dem, was im Phänomen inhaltlich gegeben ist und Noesis als dem Akt dieses Erscheinens. Methodisch nachvollziehbar wird diese noetisch-noematische Differenz in der Ausschaltung der Weltgeltung des phänomenalen Gehaltes, in der von Husserl so geannten Epoché, die eine Aufhebung alles Transzendenten zugunsten dessen vornimmt, was im Phänomen selbst gegeben ist. Von der äußeren Wahrnehmung eines Gegenstandes bleibt also im Vollzug der Epoché dessen Anspruch, sich auf einen real existierenden Gegenstand zu beziehen und das Phänomenale der Wahrnehmung selbst. Dieses wiederum lässt sich in einen ideellen und einen reellen Gehalt differenzieren, wonach das Reelle v. a. in der aktualisierten Teilanschauung des Gegenstandes besteht, damit jedoch noch keinen Gegenstand bildet, da dieser erst durch eine intentionale Auffassung des Reellen konstituiert wird. Das Intentionale bildet also das Ideelle, insofern auf Basis eines reell Gegebenen ein Gegenstand vermeint wird, welcher in jenem allein nicht gegeben ist.
Bereits an dieser Stelle beginnen die Differenzen von der klassischen Phänomenologie Husserls zur Lebensphänomenologie, da beide wohl die Epoché als grundlegenden methodischen Schritt ansehen, aber Henry sich in der Folge dafür interessiert, wie das Phänomen sich an sich selbst offenbart, während Husserl die Erscheinungsweise in der Evidenz der adäquaten Anschauung aufgehen lässt. Mit anderen Worten interessiert sich Husserl für das Erkennen von Gegenständen, für den Erweis der Gültigkeit von logisch-mathematischen Gesetzen und für das Wesen eines jeden Gegenstandes, Wertes oder Gesetzes (epistemische Fülle). Henry hingegen richtet sein Interesse auf die innere Struktur der Immanenz des Phänomens, welche in der Epoché freigelegt wurde (Fülle des Sich-Gegebenseins). Es liegen damit divergierende Interessen vor: das Sich-Erscheinen des ontischen Gehaltes von Phänomenen ist für Husserl keine selbstständige Frage, da das Phänomen in seiner Evidenz fraglos gegeben ist und in dessen etwaiger Erfüllung in der adäquaten Anschauung seinen Anspruch auf Transzendenz erfüllen kann, wenn es einen solchen Anspruch hat. Henry hingegen kritisiert diesen Evidenzbegriff als naiv, da Evidenz nur so viel heißt, nicht bezweifelt werden zu können, nicht jedoch angibt, wie es sich an sich offenbart. Diese Frage nach der inneren Struktur des Sich-Erscheinens wird durch die Gegenreduktion von Henry besonders herausgestellt, in welcher das Phänomen über die Epoché Husserls hinaus als transzendentale Affektivität (Pathos) erfasst wird.
Diese Wegscheide ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Phänomenologie, weil hier neu bestimmt wird, was Fülle und was Leere ist. Da die Weise der Erscheinung bei Henry in seinem ontologischen Grund als transzendentale Affektivität bestimmt wird, kann in der Folge das Primat des intentionalen Gegenstandes, das in der Phänomenologie Husserls angelegt ist, überwunden werden. Entscheidend für die „Leere“ oder „Fülle“ eines Phänomens ist nicht die (vor)intentional aufgefasste Hyle, sondern jene Kraft, die all diese Bestimmungen in ihrem Sich-Erscheinen ermöglicht. Der Wert dieser Neubestimmung Henrys lässt sich an der Auffassung der Müdigkeit zeigen: meint Müdigkeit einen Mangel auf die Weise, selbst einer zu sein, oder phänomenalisiert sich die Müdigkeit als Mangel gerade in einer Fülle, um sich so an sich selbst zu zeigen? Die lebensphänomenologische Antwort findet sich darin, dass der Mangel, um Mangel sein zu können, sich als Fülle an sich selbst zeigen können muss. Der Mangel als solcher ist ein bloßes Fehlen, was sich selbst nicht manifestieren kann. Der Mangel hingegen, der sich an sich offenbart, muss notwendig eine Fülle sein, in der sich Mangel und Fülle nicht gegenüberstehen, da es zwei Ebenen gibt: die Ebene des Intentionalen (Was) und die des Sich-Erscheinens (Wie). Diese Ebenen bilden eine Identität auf diese Weise, dass die transzendentale Affektivität sich so auf sich zu beziehen vermag, einen ontischen Gehalt auszubilden, ohne die unbedingte Differenzlosigkeit in ihrem Selbstbezug aufzugeben.
Wenn man auch diese fundamentalontologische Lesart Henrys als spekulativ einordnet, muss man doch einräumen, dass darin ein neues Verständnis von Mangel und Fülle besteht, welches nichthermeneutisch angelegt ist. Die naheliegendste Frage bei einem Phänomen wie der Müdigkeit ist, wie dieser Mangel zu beheben sei, so dass eine andere Frage nicht gestellt wird: wie zeigt sich der Mangel an sich selbst, um Mangel sein zu können? Was fehlt, ist eine Perspektive, in der immer von der Phänomenalisierung aus gefragt wird, und nicht von dem Phänomenalisierten. Fragt man mit Henry nach diesem Sich-Gegebensein des Mangels, kommt man notwendig zu einer Fülle. Für die Praxis der Psychotherapie spielt eine solche Erweiterung des Begriffspaars „Mangel/Fülle“ eine große Rolle, da psychische Störungen oft in einem Mangel der Zugehörigkeit zu sich selbst bestehen (Dissoziation, Depression, Depersonalisierung etc.), der jedoch richtig betrachtet, keineswegs reiner Mangel für sich ist. Durch das Erkennen der Fülle im Mangel ergibt sich ein Horizont neuer Therapiemöglichkeiten.
In der Phänomenologie und dem Denken, das eine gewisse Nähe zu ihr besitzt (Deleuze), ist diese Einheit von Mangel und Fülle nicht unbekannt, doch Henry fasst sie in einem methodischen Sinne, so dass sie nicht nur Randbemerkung bleibt. In dieser methodischen Ausrichtung steht sie auch für eine radikale Kritik an der Phänomenologie (Husserls, Heideggers) als hermeneutisch aufgeladen. Diese Kritik besagt im Kern, dass das Phänomen fundamentalontologisch nicht von seinem Erscheinungsgehalt her zu verstehen ist. Und stärker noch ist die Frage nach dem Sinn und der Bedeutung von phänomenal Gegebenen nach Henry nur eine mögliche Frage, die nur auf Basis des Sich-Gegebenseins des Phänomens gestellt werden kann. Damit will Henry der starken Tendenz zur Ablösung des ideellen Gehaltes des Phänomens von seiner Selbstpräsenz entgegenwirken, die sich bei Husserl und Heidegger auf je eigene Weise findet.
Diese Kritik an der Hermeneutik öffnet ohne Frage neue Horizonte und führt zu nichts weniger als zu einer Neubegründung der Phänomenologie selbst. Schwierig für den Leser Henrys ist es jedoch, gerade diese Nicht-Hermeneutik auf eine dezidiert hermeneutische Weise präsentiert zu bekommen. Gemeint ist Henrys Ansatz, durch eine kritische Lektüre klassischer Texte der Philosophie zur Frage der inneren Struktur des Sich-Erscheinens der Phänomene zu gelangen. Ein phänomenologisches Vorgehen sähe indessen anders aus, da es an den Phänomenen selbst ansetzte, also nicht eine Textexegese betreiben würde, sondern gemäß Husserls Maxime „zu den Sachen selbst“ strebte. Statt der Texte von Descartes, Kant, Hegel etc. würden Phänomene darauf befragt werden, wie sie sich an sich selbst zeigen. Es gibt bei Henry jedoch keine deskriptiv-phänomenologischen Analysen, welche Voraussetzung dafür wären, die Epoché überhaupt zu vollziehen. Der Begriff der Epoché als solcher steht nämlich außerhalb der Phänomenologie, da nur die vollzogene Reduktion effektiv eine solche ist und der Begriff der Reduktion selbst keine.
Genealogisch betrachtet beginnt eine Phänomenologie stets bei den Phänomenen, welche einer Epoché unterzogen werden, so dass jenes bleibt, was das jeweilige Phänomen an sich ist. Der Lebensphänomenologe muss dann im nächsten Schritt phänomenologisch aufweisen, dass sich das Phänomen nicht evident selbst gegeben ist, sondern dass es sich an sich so selbst affizieren muss, dass es sein Sich-Erscheinen wie seinen Erscheinungsgehalt sicher stellt. Im Zentrum der Lebensphänomenologie Henrys steht jedoch nicht die Arbeit an und mit den Phänomenen, sondern mit kanonisierten Texten der Philosophiegeschichte. Dieses Vorgehen ist weder phänomenologisch, noch aus dem Leben geschöpft, wie man es erwarten könnte, sondern reine Textarbeit.
So haben alle zentralen Begriffe der Lebensphänomenologie, die Ipseität, der Leib, die transzendentale Affektivität, das Historiale etc. einen hermeneutischen Ursprung, der darin besteht, Texte der Philosophiegeschichte so zu lesen, dass deren Unzulänglichkeiten und inneren Widersprüche zusammen genommen einen verborgenen Urtext zu Tage fördern, der nie geschrieben und intendiert wurde, doch implizit in der Textzusammenstellung Henrys gegeben ist.
Sebastian Knöpker