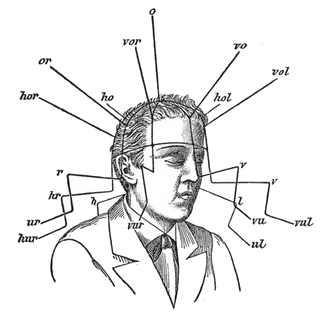Sebastian Knöpker
Der Philosoph und Schriftsteller Michel Henry (1922-2002) ist einer der wichtigsten Vertreter der Phänomenologie in der Nachfolge Husserls. Henry gelang eine Neubegründung der Phänomenologie, die er nicht mehr vom Erkennen her begründet sieht, sondern vom Fühlen. Das Affektive ist bei Henry nicht mehr eine Randgröße, sondern rückt so in das Zentrum der Phänomenologie, dass alles Wahrnehmen, Erkennen, Denken und Wollen letzthin in Affektivität besteht. Anders ausgedrückt will Henry das, was wir unter Leben verstehen, stets als affektive Größe verstanden wissen. Leben ist demnach für Henry das, was sich selbst gegenwärtig ist (Selbstaffektion), eine Selbstpräsenz, die nur durch Affektivität geleistet werden kann.
Die existenzielle Bedeutung diese fundamentalontologischen Ansatzes besteht darin, dem Leben wieder einen Ort zu geben, eine Bleibe (demeure), wie Henry selbst sagt. Die Ortlosigkeit des Lebens ergibt sich daraus, dass wir dazu tendieren, das Leben durch Stellvertreter und Äquivalente zu ersetzen: Fühlen kann demnach als biochemischer Prozess aufgefasst werden, die Arbeit als bloßes Hervorbringen von Produkten, der gefühlte Leib als Körper, also als Ding unter Dingen, die gelebte Zeit als physikalische Abfolge von Ereignissen, der gelebte Raum als dreidimensional Ausgedehntes, die eigene Biographie als chronologische Sammlung von Fakten usw. Henry sagt vor diesem Hintergrund, dass die Wirklichkeit des Lebens von den quantitativen Größen einer objektiven Wirklichkeit, der Zeit, dem Geld, dem Recht etc. aufgesogen wird, so dass es in seinem Innersten bedroht ist.
Was aber bedeutet diese Gefahr? Die Wirklichkeit als solche ist jedenfalls nicht bedroht. Denn wenn auch einzelne Dinge verschwinden, so existieren sie unter anderer Form weiter. Gletscher können schmelzen, Papier kann zerfallen und Land vom Meer überschwemmt werden, aber die Wirklichkeit selbst setzt sich unbeirrt fort. Die Dinge „machen also immer weiter“, die Preise entwickeln sich weiter, die sozialen Lagen „machen weiter“, so wie auch die Zeit weiter geht und sich stets neue Konstellationen ergeben.
Können die Dinge als solche auch nicht verschwinden, so kann doch das Erleben der Dinge schwinden. Das Subjektive am Objektiven, ihr Erleben, ist auf die Weise bedroht, dass das Leben von Dingen und Sachverhalten in der Welt abhängig gemacht wird und demnach das Leben nur dann zur Fülle gelangt, wenn sein Erleben von einem objektiv Existierenden autorisiert ist. Lebt man sein Leben auf diese Weise, so lebt man in der Überzeugung, dass das Leben Sinn, Fülle und Gelingen nur in der Teilhabe an dem finden kann, was es nicht ist. Auf der einen Seite steht dann das Leben, was an sich nichts ist und auf der anderen Seite der Horizont der Welt, der Anderen und der Ideen, dessen Sein erst das Sein des eigenen Erlebens legitimieren kann. Die Herkunft der Lebendigkeit des Lebens wird dann in diesem Horizont des Außen gesetzt, so dass die Grundformel gilt: Dasein ist nur so möglich, dass es an einem Sein vor dem Dasein Teil hat.
In dieser Grundüberzeugung verliert sich das Leben auf die Weise, als dass es zu seiner Bedingung macht, stets ein Gegenstück in der Welt zu haben, um etwas erleben zu können. Doch das Leben braucht keine solche Absicherung, so Michel Henry, weil es sich aus sich selbst gewinnt und sich so immer schon hat. Das Grundprinzip der Lebensphänomenologie Henrys ist es, dass nichts aus der Welt das Leben affizieren kann, sondern nur eine Selbstaffektion des Lebens eine Fremdaffektion in sich aufzunehmen vermag. Der zum Greifen nahe seiende Gegenstand selbst ist nach Henry niemals in der Lage, von sich aus zu einem Erlebnis eines Menschen zu werden. Er ist darauf angewiesen, dass er von der Selbstaffektion des Lebens zur Lebendigkeit gebracht wird.
Dass sich das objektiv Gegebene in der Welt nicht von sich aus dem Menschen als Erlebnis gibt, zeigt das häufige Scheitern der Erlebniswerdung dessen, von dem man weiß, was er an Erlebnis zu bieten hat, das sich jedoch nicht als Erlebnis geben will. Dieser scheiternde Übergang vom Ding als Objektiven zum erlebten Gegenstand als Subjektives zeigt sich alltäglich in der Konsumgesellschaft. Man verfügt über eine Vielzahl an Gegenständen, hat sie in der Hand, aber kann sie dennoch als Erlebnis nicht ergreifen. Präsenz ist also nicht gleich Präsenz, ein Unterschied, der sich auch in der misslingenden erotischen Begegnung manifestiert, in der man auf den Körper als Ding unter Dingen zurückzugreifen versucht, aber nicht viel mehr als eine warme, weiche Masse zu greifen bekommt.
Probleme dieser Art beruhen wesentlich darauf, dass man das Leben und das Erleben in Analogie zum Gegenständlichen auffasst, also als Fremdaffektionen, die sich gemäß der objektiven Eigenschaften des jeweiligen Gegenstandes erfahren lassen. Das Leben hat sich dabei auf die Weise entäußert, den Ursprung seiner eigenen Lebendigkeit außerhalb von sich zu suchen. Es sucht genauer bestimmt seine Fülle in Äquivalenten des Lebens, die als das Leben selbst auftreten, so wie etwa in der Ökonomie des Kapitalismus. Dort werden der Wert und die Wirklichkeit der Erwerbsarbeit durch einen komplexen Verweisungszusammenhang bestimmt. Die tatsächlich geleistete Arbeit gerät dabei in die Abhängigkeit idealer ökonomischer Bestimmungen, welche eine Teilhabe des Wirklichen, nämlich der Arbeit, an einer ökonomischen Wirklichkeit des Absatzes, der Besteuerung, der Preisfindung des Produzierten etc. vorschreibt. Gelingt diese Teilhabe der subjektiven Wirklichkeit an der objektiven Wirklichkeit nicht, so wird die Arbeit entwertet und gilt kaum noch etwas.
Eine solche Vermittlung von Leben durch Gegenstände, Konstellationen und Idealitäten außerhalb des Lebens führt zu einer Subversion des Lebens selbst, wonach es sich nicht mehr zu empfinden vermag. Diese Problematik findet sich im Konsum, in der Erotik, in der Arbeitswelt und bei näherer Betrachtung in jedem Lebensbereich. Die Herkunft des Lebens, ihr Ort, ist jedoch nicht die Welt, so Michel Henry, da sein Ursprung in ihm selbst liegt. Henrys Philosophie argumentiert für diesen Ursprung des Lebens im Leben selbst zum einen ontologisch, zum anderen als praktisches Leitmotiv für das Leben. Für Michel Henry kann es keinen Übergang des objektiv Existierenden in das subjektiv Erlebte geben, weil das objektiv Seiende keine Wirklichkeit im Sinne der Selbstpräsenz hat. Zwar existiert es, aber es existiert nicht auf die Weise, dass es sich selbst präsent ist, so dass in der Fülle objektiven Seins also ein vollständiger Mangel an jener Wirklichkeit herrscht, die in Selbstgegenwart besteht.
Seine Wirklichkeit kann das Leben von daher nur aus sich selbst beziehen, genauer bestimmt aus einer Affektivität, welche sich so auf sich selbst zu beziehen mag, dass sie sich nicht von sich abwendet. Das Affektive ist in Henrys Lebensphänomenologie also der Grundstoff allen Sich-Gegebenseins. Dieser These stimmt man dabei leicht zu, geht es um reine Gefühle, von denen man aus eigenem Erleben weiß, dass sie durch kein Sein außerhalb ihres Spürens in ihrer Wirklichkeit autorisiert werden müssten. Doch Henry geht weit darüber hinaus: die Affektivität ist der „Stoff“, der alles zur Selbstpräsenz gelangen lässt und zwar so, dass auch der abstrakte Gedanke affektiver Natur ist. Alles Denken, Wahrnehmen, Schlussfolgern, Vorstellen etc. ist auf diese Weise affektiv bestimmt. Das abstrakte Denken beispielsweise beruht nicht etwa auf der Affektivität oder steht mit ihr mittelbar in Verbindung, sondern der Gedanke ist eine affektive „Gestalt“. Es gibt also in lebensphänomenologischer Einstellung keine Differenz der Affektivität zu ihrer jeweiligen Erscheinungsform, und sei diese scheinbar auch noch so weit von dem entfernt, was man unter Affektivität versteht. Man kann es auch so formulieren, dass jegliche Selbstpräsenz (Bewusstsein) ihr Sich-Erscheinen einem Bezug der Affektivität auf sich selbst verdankt, weil nur in dieser affektiven Differenz das Leben sich an sich selbst zu offenbaren vermag. Dabei ist das wirkende Prinzip des Sich-Erscheinens immer unsichtbar, weil die Affektivität nur gefühlt, aber nicht sinnlich wahrgenommen werden kann, wohingegen der konkrete Erscheinungsgehalt in der Regel sichtbar ist. Dieser ist distinkt wahrnehmbar, lässt sich oft quantifizieren und ist kategorisierbar, so dass scheinbar nur das zählt, worauf sich zeigen lässt.
Die Subversion der Lebenswirklichkeit besteht dabei nicht nur in der Selbstabdankung des Lebens, also in dem Nachlassen seiner Intensität, sondern auch im Leiden an sich selbst. Denn wenn das Leben sich nicht in positiven Formen verwirklichen kann, dann verliert es sich nur zu einem Teil. Was bleibt, ist das, was sich als ein Sich-Erleiden manifestiert, also als ein Wille, von sich weg zu wollen, ohne von sich ablassen zu können. Gerade in dieser unbedingten Selbstbindung des Lebens an sich findet sich dann eine Selbststeigerung, allerdings eine unter dem Vorzeichen des Leidens an sich. Dabei kann dieses Leiden gerade darin bestehen, sich in seiner Leere zu empfinden. Leere und Mangel sind aber lebensphänomenologisch so zu verstehen, dass ein Mangel sich als Mangel an sich nur so manifestieren kann, dass er in sich Fülle ist. Würde die gefühlte Leere reine Leere sein, so könnte sie nicht mehr gefühlt sein, so dass mit Henry zwischen dem, was ein Gefühl ausdrückt, also der Leere, und dem, was diesen Ausdruck in seinem Sich-Erscheinen ermöglicht, unterscheiden müssen. Da also, wo sich das Leben am meisten fehlt, ist es am stärksten an sich gebunden.
Neben dem Verlust an Lebendigkeit und der Tendenz, nicht gelebtes Leben doch noch als Sich-Erleiden zu empfinden, sieht Michel Henry insbesondere in der Unfähigkeit, ein Gefühl aus sich selbst heraus zu empfinden, eine folgenschwere Subversion des Lebens. Üblicherweise empfindet man Gefühle aus ihrem Bezug auf Ursache, Gründe und Folgen, wodurch ihr Empfindungscharakter bestimmt wird. Wenn man jedoch ein Gefühl in seiner reinen Selbstpräsenz zu empfinden vermag, so zeigen sich in ihm ganz andere affektive Tonalitäten. In Bezug auf das Leiden meint das konkret eine Wandlung (Modalisierung) des Gefühls vom Charakter des Schmerzes hin zu dem des freudigen Empfindens der eigenen Intensität. Denn Leiden besteht immer auch in der Empfindung der eigenen Lebensintensität, wobei diese Intensität an sich eine affektive Tonalität ist und nicht bloß die Intensität eines Gefühls bezeichnet. Die Entdeckung der Intensität als eigenständige Gefühlstonalität hat aber zur Voraussetzung, von allen Ursachen und Gründen im Horizont der Welt abzusehen. In diesem Absehen von den Gründen, so Henry, zeigt sich ein Fühlen neuer und im Modus des intentionalen Fühlens unbekannter Tonalitäten. Die Lebensphänomenologie hat es also zum Ziel, eine Gefühlskultur aufzuzeigen, die weit über das hinaus geht, was Gefühle in ihrer jeweiligen Bindung an ihre äußeren Ursachen bedeuten.