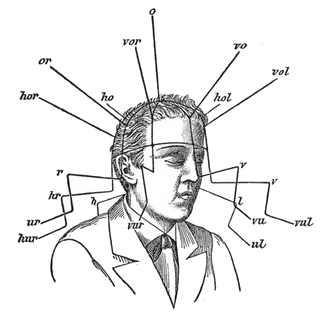Was kann schlimmer als ausgelassene Freude sein, wenn man selbst trauert? Was stört noch mehr als die fröhlichen Nachbarn, wenn man im Garten die geliebte Katze beerdigt? Sicher eben so schlimm ist das Mitleid mit einem sterbenden Menschen, der selbst gar nicht traurig ist, sondern in gelöster Stimmung.
Wie selbstverständlich gehen Angehörige und Freunde in der Regel davon aus, dass der Sterbende mit seinem Schicksal hadert und niedergeschlagen ist. Tatsächlich wechseln sich aber in seinem Empfinden oft Phasen der Hochstimmung mit Angst und Verunsicherung ab. Muss er dann seine Gefühle verbergen oder vereinfachen, um es den Angehörigen möglichst leicht zu machen, wird das Sterben zu einer letzten Anstrengung.
„Mir geht es gut“ kann also ein Satz sein, der nicht zur Beschwichtigung dient, sondern eine schlichte Feststellung ist. Wie diese Freude am Dasein zustande kommt, zeigt der von einer schweren Krankheit geheilte Mensch: Teilt ihm der Arzt mit, dass er ohne Befund ist, so wird er die nackte Tatsache zu leben als Freude empfinden. Die alten Griechen nannten diese Daseinslust Ataraxie, die Meeresstille der Seele. In der Meeresstille wird sich das Leben ganz unabhängig von den näheren Umständen zum Behagen. Die sonst neutrale und unbeachtete Tatsache des Daseins wird zum alleinigen Grund zur Freude am Leben.
Auch für den Todgeweihten kann die Lebensgewissheit in der Gegenwart das entscheidende Kriterium sein, das über Lust oder Unlust, über Glück oder Leiden entscheidet. Der Tod lässt dann die nur scheinbar offenkundige Tatsache neu entdecken, überhaupt am Leben zu sein. Das Gegenteil dazu findet sich im weiten Feld der Depression. In ihr wird die Existenz vor jeder konkreten Eigenschaft zur Unlust, zum Verdruss am Leben. Man ist verdrossen, weil man lebt, so wie man in guten Momenten in gelassene Freude gerät, weil man sich empfindet. Der nahe Tod kann dabei sowohl Daseinslust wie depressive Episoden auslösen. Das Leben ist so als bloße Tatsache seinem Wesen nach unsachlich. Es ist keineswegs auf unbedingte Neutralität verpflichtet und wird sich schnell zu Schwere oder zu Leichtigkeit, zu Behagen oder Unwille.
In welche Richtung diese Unsachlichkeit ausschlägt, ist dabei eine Frage des Verhältnisses zum eigenen Leben. Das ist vom Alltag nicht so weit entfernt, wie man glaubt. Denn wer in die Sauna geht, der möchte seinen Körper durch die Hitze und die Feuchtigkeit in einen authentischen Selbstgenuss versetzen. Das Empfinden des eigenen Körpers reicht dann aus, um ein Wohlbehagen auszulösen. Dasselbe findet sich beim Bad im eiskalten Wasser, wo man nach dem ersten Schock der Kälte schon bald in eine Freude am Empfinden durchblendet.
Für den Sterbenden ist es ebenfalls so, dass er die Tatsache zu leben neu entdecken kann. Nur wird er dazu gezwungen, da er nicht wählen kann, ob er ein Gefallen an der bloßen Existenz durch einen Marathonlauf oder ein Bad im Eiswasser entwickeln möchte. Der Sterbende fällt aus der Welt, da sein Alltagshorizont der Probleme und Projekte verschwindet und verblasst, um eine andere Kausalität von Lust und Unlust zu öffnen. Im Sterben ist es die Tatsache zu leben, die zum Auslöser paradoxer Gefühle wird: einmal der Untröstlichkeit über das nahende Ende, einmal des Genusses am Selbstgefühl. Einige Menschen sterben dabei erst im allerletzten Moment, andere fangen schon früher damit an.
Manche empfinden im Tod nichts, kein Drama und keine Zuspitzung, während andere sich ihren Tod bereits in der Kindheit ausmalen müssen. Für den Sterbebegleiter ist die Trostlosigkeit im Angesicht des nahen Endes dabei das Erwartete, während die rauschhafte Zuneigung zum Leben oft Irritationen auslösen mag. Diese Lust ist zunächst ungewöhnlich und erscheint auch unpassend zu sein. Sie als Überspanntheit einzuordnen wird dem Verhältnis zum Sterbenden aber nicht gerecht werden. Darin steckt ein Mangel an Ernst, der gerade besteht, die Daseinslust als Bindung zum Leben als bloße Tatsache zu begreifen. Der Ernst der Lage des Sterbenden erweist sich nämlich gerade darin, ein Verhältnis zu sich vor jeder Eigenschaft in der Welt einzugehen, also in diesem Fall zu seiner Lebendigkeit vor jeder Prägung im Horizont der Welt. Beim Verzicht auf aufgesetzte Gefühle wird dann aus Mitleid eine Mitfreude.
Sebastian Knöpker