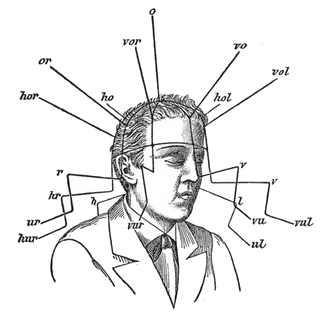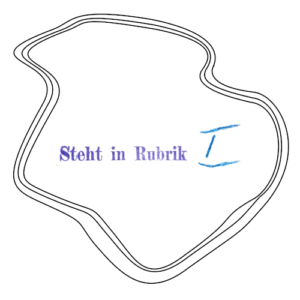 Die Dringlichkeit hat oft ein Qualitätsproblem. Was drängt, ist weniger inhaltlich motiviert als vielmehr ein unglücklicher Lebensstil. Das Dringende bekleckert den dringenden Menschen. Authentisch ist es meist nur in der Literatur.
Die Dringlichkeit hat oft ein Qualitätsproblem. Was drängt, ist weniger inhaltlich motiviert als vielmehr ein unglücklicher Lebensstil. Das Dringende bekleckert den dringenden Menschen. Authentisch ist es meist nur in der Literatur.
Was unaufschiebbar ist, hat oft ein sehr lockeres Verhältnis zu seinem Inhalt. Das Drängen steht in erster Linie für sich: es zieht, hebt, drängt, ohne genau darauf zu achten, um was es eigentlich geht. Das merkt man dann, wenn man wie Seneca am Abend prüft, was den Tag über so akut schien. Ergebnis: so wichtig war es nun auch wieder nicht.
Zudem ist das Dringende oft nur locker an das Ego des Bedrängten gekoppelt. Es geht in erster Linie nicht um das, was dem Ich dringend sein sollte, da das Drängen zum Ich kommt und es mit sich erfüllt. Es ist also sehr unpersönlich, so dass das so Dringliche zumindest bei den Mitmenschen in den meisten Fällen mit Fragezeichen versehen wird. Sich selbst durchschaut man nicht so leicht, aber der Zweifel an der Dringlichkeit ist auch hier angebracht.
Echte Dringlichkeit gibt es eigentlich nur dort, wo sie sicher erfunden oder aus zweiter Hand ist, so wie in der Literatur. Beim Lesen von Charles Baudelaires Briefen an seine Mutter, die er sein ganzes Leben lang aufs Eindringlichste um Geld anpumpt, kann man das Gefühl des Drängenden in Reinform erleben.
Baudelaire war Zeit seines Lebens derart bedrängt von Geldsorgen, dass sie in seinen Briefen in ihrer nackten Form für jeden Leser im Moment des Lesens erlebt werden. Seine Briefe haben nichts Literarisches, sind schnörkellos, aber gerade deswegen so eindringlich: hier geht es ums Wichtigste, ums Geld.
Man kann sich also aus Baudelaires Briefen Dringlichkeit ausleihen, ein Gefühl, das sonst keinen Spaß macht, aber befreit vom Bezug auf das eigene Ich, dann doch erfreulich verlebendigend wirkt. Ein Gefühl, das sonst rundheraus unerfreulich ist, wird so zu einer lebendigen Lust.
Sebastian Knöpker